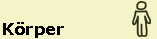|
| |
|
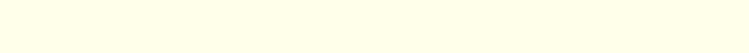
Zitieren sie diesen Text
bitte folgendermaßen:
Trierweiler, Sandra:
Rollenverhalten. In: Webportal für
die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte
der Universität Wien,
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/sozialisation/beziehungen_02.htm
Rollenverhalten ? !
In diesem Essay soll es um das Rollenverhalten von Männern
und Frauen gehen.
Dass diese Rollen durch lange Prozesse entstanden und deshalb nicht einfach
auszulöschen sind, ist klar. Viel interessanter ist jedoch die Frage,
wann sie entstanden sind und warum.
Die Ansicht, dass Muttersein die Erfüllung einer Frau ist und zu
ihrer Natur gehört, stammt nicht aus der Antike oder dem Mittelalter,
sondern aus der Aufklärung und die ist gar nicht so lange her.
In dieser Zeit wird die frühneuzeitliche Rollenverteilung ad acta
gelegt und man schafft einen neuen Raum der Privatheit für die Frau,
in dem sie ganz in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau aufgehen kann. Der
Ehemann wird somit zum Sinn ihres Lebens, ja vielleicht sogar zu ihrer
einzigen Daseinsberechtigung neben der Mutterschaft. Dies gilt jedoch
nicht im umgekehrten Fall.
Der Mann als kulturschaffendes Geschöpf wandelt die Natur nach seinen
Vorstellungen in Kultur um. Deshalb ist er auch immerwährender Erzieher
und Herr seiner Frau, die ein Geschöpf der Natur ist. Er verdrängt
sie aus dem öffentlich-politischen Leben und steigt so in der Hierarchie
weit über sie hinaus.
Die Militarisierung macht den Mann dann endgültig zu dem, was wir
heute als männlich bezeichnen: durchtrainiert, stark, unnachgiebig
gegen den eigenen Körper, ein tapferer Soldat und autonomer Mann.
(1)
Diese Rollenbilder von der Frau am Herd und dem Mann, der das Geld nach
Hause bringt, sind also gar nicht so alt, wie wir immer glauben –
gerade mal 200 Jahre. Doch als moderner, intelligenter Mensch sollte man
meinen, dass man aus ihnen ausbrechen kann.
Die neue Generation von Männern und Frauen, von der alle sprechen,
sollte frei sein von jeglichem Rollendenken: beide Geschlechter können
ihre Karriere verfolgen, der Haushalt wird gemeinsam erledigt, Kinder
von beiden Elternteilen erzogen und Frauen haben in jeder Hinsicht die
gleichen Rechte wie Männer.
Diese Vorstellung mag schön sein, ist aber meiner Meinung nach in
der Realität so nicht zu beobachten. Und zwar deshalb nicht, weil
wir noch immer in unseren alten Rollen festsitzen und auch keine wirklichen
Ambitionen zeigen, diese zu verlassen.
Wie sonst lässt es sich erklären, dass noch immer 95 % der Erziehungsarbeit
Frauensache ist, trotz der vielen Angebote für Karenzurlaub für
Männer in vielen Ländern Europas. (2)
Schon Kinder zeigen ein deutlich fixiertes Rollenverhalten
und das liegt nicht immer zwangsläufig an der Erziehung oder an biologischen
Gegebenheiten. Obwohl die Biologie in Hinsicht auf unser Verhalten als
Mann und Frau nicht zu verachten ist.
Ob ein Embryo ein Junge oder ein Mädchen wird, liegt an männlichen
und weiblichen Geschlechtshormonen. (männlich: Androgene wie Testosteron
oder Androstendion; weiblich: Östrogene) Diese Hormone beeinflussen
aber nicht nur unser Geschlecht, sondern auch unser Aussehen – dass
Männer eine Glatze bekommen, liegt letztendlich an Testosteron. Und
Hormonforscher konnten inzwischen beweisen, dass diese Hormone auch auf
unser Verhalten wirken, z.B. wenn es um Sex geht.
Männer und Frauen handeln aus anderen Gefühlswelten heraus.
Ein Mann steht einem One-Night-Stand grundsätzlich nicht abgeneigt
gegenüber, wohingegen es Frauen meistens bei der Phantasievorstellung
belassen. (3)
Dies liegt jedoch nicht allein an der Doppelmoral in unserer Gesellschaft,
die Frauen, die ihre Sexualität frei ausleben, brandmarkt, denn der
Evolutionsforscher David Buss hat die Übereinstimmung in dieser Frage
bei über zehntausend Personen in 37 verschiedenen Kulturen festgestellt.
(4)
Viel mehr liegt es an den Hormonen, die uns zu einer gewissen Verhaltensweise
zwingen. Testosteron ist das Hormon, das uns aktiv nach Sex suchen lässt.
Auch Frauen produzieren dieses Hormon, aber Männer tun dies in zwanzig
Mal höherem Ausmaß. Hingegen erzeugen Östrogene, die vorherrschenden
Sexualhormone bei Frauen, ein stärkeres Verlangen nach einer Bindung.
Also ist die Rollenverteilung, zumindest wenn es um Sex geht – nämlich,
dass Frauen Bindungen und Männer Sex anstreben – nicht vernunftgesteuert
oder von der Gesellschaft vorgeschrieben, sondern unser biologisches Erbe.
Diese Regelung hatte früher durchaus ihren Sinn, wenn man bedenkt,
dass es in der Evolution vor allem darum geht, viele Nachkommen zu zeugen.
Männer können mit mehreren Frauen Kinder haben, ja, es ist vom
evolutionären Standpunkt her betrachtet sogar erwünscht, weil
sie so ihr Erbgut sehr weit streuen können. Frauen jedoch brauchen
für ihren Nachwuchs nur einen Mann. Der jedoch muss dann auch in
der Lage sein, die Familie zu versorgen. Dass es auch Frauen, gibt, die
ihre Sexualität ausleben, und es eben nicht bei der Phantasie belassen,
liegt daran, dass diese Frauen dann auch meistens einen höheren Testosteronspiegel
haben, als die durchschnittliche Frau. (5)
Aber es gibt noch andere Dinge, die unsere Entwicklung beeinflussen.
Die amerikanische Psychologin Judith Harris stellte die Theorie auf, dass
die Gleichaltrigen einen größeren Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung
ausüben, als die Eltern. (6)
Die hundertprozentige Richtigkeit dieser These mag dahingestellt sein,
doch wir alle konnten schon beobachten oder selbst erleben, wie Druck
von Freund(inn)en und Konkurrent(inn)en auf das einzelne Individuum ausgeübt
wird. Diese Art der Sozialisation hat nicht nur einen gegenwärtigen,
sondern auch einen zukünftigen Einfluss auf die Persönlichkeit,
denn wer schon in der Schule ein Außenseiter war, wird Zeit seines
Lebens mit Hemmungen kämpfen müssen. (7)
Dies spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es um geschlechtstypisches
Verhalten geht. Die für die Jugend so typischen Mädchen- und
Jungencliquen bringen quasi eine Selbsterziehung zur eigenen Geschlechtsrolle
mit sich. So zeigen schon zwölfjährige Mädchen die Klischees
weiblichen Verhaltens, tuscheln und kichern und verhalten sich in Gegenwart
von Jungen besonders ungeschickt. Die Kinder orientieren sich an Idealbildern
aus dem Kino und anderen Medien und legen diese auch als Bewertungsmaßstäbe
an, sodass es praktisch kein Entrinnen gibt. (8)
So hat die ganze Umgebung Einfluss auf die Persönlichkeit
eines Kindes und vor allem eines Jugendlichen.
In der Pubertät durchlaufen Menschen eine sensible Phase ihrer Entwicklung.
Gute und schlechte Erlebnisse aus dieser Zeit werden später als Maßstab
und Entscheidungshilfe verwendet. Im späteren Umgang mit dem anderen
Geschlecht wird man daher immer auf vorher gemachte Erfahrungen oder Beobachtungen
zurückgreifen. (9)
Wenn man erwachsen wird, versucht man, aus diesen Klischees
auszubrechen. Doch es gibt eine Situation, bei der Mann und Frau immer
auf sie zurückgreift – bei der Partnerwahl.
So sehr wir uns auch emanzipieren, Frauen werden sich in Gegenwart eines
attraktiven Mannes immer hilfloser anstellen, als sie es eigentlich sind,
und Männer werden immer versuchen, der Stärkste zu sein, wenn
sie eine Frau beeindrucken möchten. Das vermeintlich Erstaunliche:
diese Methoden haben meistens Erfolg.
Dies liegt teils an unserem Rollendenken, aber auch an Instinkten, die
in solchen Situationen zum Vorschein kommen.
Deshalb finden Frauen starke Männer attraktiv und suchen sich einen
genau solchen aus: weil nur er sie und ihre Kinder beschützen und
versorgen kann. Und Männer suchen sich wahrscheinlich aus genau diesem
Grund Frauen, die sie beschützen können. (10)
Dieser Gedanke wird auch in die Tat umgesetzt – ich habe jedenfalls
noch nie gehört, dass die Frau nachts das Haus nach Einbrechern durchsucht
und der Mann sich im Bett verkriecht.
Ich halte mich selbst für emanzipiert, ich muss mir
aber auch selbst eingestehen, dass ich gewissen Klischees sehr wohl entspreche
und meine Rolle genauso spiele wie alle anderen. Trotzdem bin ich auch
der Meinung, dass Frauen nicht unbedingt gleich werden sollen wie Männer.
Sie sollen die gleichen Rechte haben, die gleiche Bezahlung bekommen,
selbst Entscheidungen treffen. Aber wir sollten nicht versuchen, alle
Unterschiede, die zwischen den Geschlechtern bestehen auszuradieren. Das
Einzige, das verändert werden muss, ist unsere Einstellung zu ihnen.
Niemand muss sich wegen seines Geschlechts diskriminieren lassen, und
damit meine ich beide Geschlechter. Ich bin zwar kein Mann, aber ich denke,
dass es in der heutigen Zeit nicht leicht ist, sich als Mann zu behaupten.
Der Mann hat es meiner Meinung nach immer schwerer, weil viele Dinge,
die früher das männliche Bewusstsein stärken konnten, heute
als verpönt und frauenfeindlich gelten. Das bedeutet, dass sich Männer
andere Betätigungsfelder suchen müssen, die sie dann als Mann
bestätigen, sie müssen andere Mittel und Wege finden, um ihre
Männlichkeit auszudrücken.
Durch die Beschäftigung mit diesem Thema ist mir vieles
klar geworden. Zum Beispiel, dass man nicht krampfhaft immer darauf achten
sollte, ob irgendjemand irgendetwas gesagt hat, dass man vielleicht als
frauenfeindlich auslegen könnte. Und ich versuche auch nicht mehr,
irgendwelche Männer mit sexistischer Einstellung davon zu überzeugen,
dass wir Frauen auch zu allem fähig sind, was sie können, wenn
wir nur wollen. Ich lache heute über diese Menschen und lebe dann
mein Leben weiter. Ich tue dies so, wie ich es für richtig halte
und es mit mir selbst vereinbaren kann. Sollte ich dabei genau nach den
Klischees leben, die Feministinnen anprangern, kann ich das auch nicht
ändern. Ich mag die Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
Es sind nämlich genau diese Unterschiede im Verhalten und Handeln
von Männern und Frauen, die das andere Geschlecht für uns doch
erst interessant machen.
Anmerkungen:
(1) Wolfgang Schmale:
Männergeschichte als Kulturgeschichte; Erschienen in: „Geschlecht
und Kultur“. Beiträge zur Historischen Sozialkunde, Sondernummer
2000, Wien 2000, S. 30-35
(2) ebd.
(3) EGONET.de, Ausgabe
12/2000, „Typisch Frau – Typisch Mann“, Teil 11: Sex
oder Liebe. Warum Männer trennen, was für Frauen zusammengehört
EGONET.de, Ausgabe 01/2000, „“Typisch Frau – Typisch
Mann“, Teil 2: Am Anfang war die Frau. Biologisches, Psychisches
und Soziales in den Geschlechterrollen;
(4) ebd.
(5) EGONET.de, Ausgabe
01/2000, „“Typisch Frau – Typisch Mann“, Teil
2: Am Anfang war die Frau. Biologisches, Psychisches und Soziales in den
Geschlechterrollen;
EGONET.de, Ausgabe 12/2000, „Typisch Frau – Typisch Mann“,
Teil 11: Sex oder Liebe. Warum Männer trennen, was für Frauen
zusammengehört
(6) EGONET.de, Ausgabe
10/2000, „Typisch Frau – Typisch Mann“, Teil 9: Heulsusen
und Prügelknaben. Wie wir als Kinder gelernt haben, was eine Frau
und was einen Mann ausmacht
(7) ebd.
(8) ebd.
(9) EGONET.de, Ausgabe
Oktober 2001/4. Jahrgang, „Typisch Frau – Typisch Mann“,
Teil 19: Pubertät. Wenn aus Kindern Frauen und Männer werden
(10) EGONET.de, Ausgabe
12/200, „Typisch Frau – Typisch Mann“, Teil 11: Sex
oder Liebe. Warum Männer trennen, was für Frauen zusammengehört
|