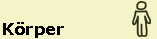
 |
WEBPORTAL:
MÄNNLICHKEITEN
|
||
| Start/Sozialisation/Vereine&Männerbünde/Reulecke | |||
|
|
Zitieren Sie diesen Text bitte folgendermaßen: Waldmüller, Hildegard:Rezension von Jürgen Reuleckes: "Ich möchte einer werden so wie die...", Männerbünde im 20. Jahrhundert. In: Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte der Universität Wien, http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/sozialisation/vereine_01.htm
„Ich möchte einer werden so wie die...“ Männerbünde
im 20. Jahrhundert Jürgen Reulecke, geb. 1940, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Siegen, setzt seine Schwerpunkte als Historiker in der deutschen Sozial-, Kultur- und Verfassungsgeschichte, insbesondere auch in der Arbeiter- und Jugendbewegung. Mit dem vorliegenden Werk widmet er sich einem bis jetzt nur punktuell behandelten Forschungsgebiet, nämlich dem Männerbundsyndrom des 20. Jahrhunderts, am Beispiel der Entwicklung deutscher Jugendbewegungen vom Beginn der Wandervogelbewegung bis in die Sechzigerjahre als einen der möglicherweise entscheidenden Faktoren der deutschen Nationalgeschichte. Der Titel des Buches ist einem seinerzeit sehr populären Gedicht Rilkes aus dem Jahr 1902 entnommen. Davon und von der Frage, ob „zornige junge Männer“ und der Protest der Jugend ein Kennzeichen des 20. Jahrhunderts seien, ausgehend, beschreibt der Autor die Aufbruchsstimmung in der jungen Wandervogelbewegung Deutschlands gegen eine als verlogen und verknöchert angesehene „Plüschkultur“. Wilhelminisches Männlichkeits-gehabe, nach dem die männliche Ehre unter Umständen nur durch ein Duell auf Leben und Tod gerettet werden kann, haben die Wandervögel satt. Jugend wird zum Mythos, die Begegnung mit der Natur in der Gemeinschaft der Gruppe vermittelt Begeisterung und rauschhaftes Lebensgefühl. Besonders höhere Schüler und Studenten aus dem städtischen Bereich fühlen sich angesprochen, wenn die „Welt der Philister“ überwunden werden soll. Erst der Männerbund befreit den Mann zu voller schöpferischer Freiheit. Dagegen wird die Familie nur als Aufzuchtsort von Kleinkindern und Mädchen, als destruktiv und als Domäne der Frau angesehen. So kommt zwar auch eine Diskussion über weibliche Wanderbewegungen zustande, die bis weit ins 20.Jhdt. hineinreicht, und es bilden sich tatsäch-lich auch rein weibliche oder gemischte Gruppen; herrschende Meinung bleibt jedoch, daß Männer und Frauen konträre Triebe hätten und die Teilnahme von Mädchen zu „seichter Gleichmacherei“ und femininen Männergruppen führen würde. Im Ersten Weltkrieg geht es für den Wandervogel darum, sich an der „Heimatfront“ in schweren Zeiten zu beweisen. Gleichzeitig wandelt sich das Männerbild vom Kämpfer zum Krieger. Angelehnt an ein idealisiertes Germanentum wird der Krieg als Chance zu mannhafter Bewährung und zur Überwindung der verweichlichenden „welschen“ Zivilisation gesehen. Der Mann muß im Ernstfall zum Kampf bereit sein: Krieger wird zum männ-lichen Lebensberuf schlechthin. Reulecke ergänzt seine Ausführungen durch die Analyse bildlicher Schlachtendarstellungen von 1870/71 bis 1918: Zeigen ältere Bilder noch eine gewisse Naivität, so treten ab ca. 1916 indivi-duelle männliche Physiognomien hervor, die Ernst, Gehorsam, Opferwillig-keit und Treue zum Männerbund vermitteln. Das Bild des Kriegers fließt nach Kriegsende in das Idealbild des Deutschen ein, der – in sublimierter Homoerotik idealerweise in ordensähnlichen Ge-meinschaften lebend - männlich hart, sehniger und kräftiger werden und „zuchtlosen Banden laut johlender Burschen und Mädchen“ in männlicher Einfachheit entgegentreten solle. Das Leitbild deutscher Hochschulgilden nach 1920 lautet: „deutsch, wehrhaft, fromm“. Gemäßigte Führungskreise bemühen sich, in der Jugend politisches Bewußtsein zu etablieren, Bildungsprogramme und Kulturinitiativen werden entwickelt, ein letzter Versuch, in der Zeit des offensichtlichen Niedergangs des parlamentarischen Systems die politische Mitte zu stärken. Daneben etablieren sich rechtsextreme Jugendbünde (1925 Hitler-Jugend), das militant-rassistische Führer-Prinzip setzt sich durch. Der Autor analysiert bündisches Liedgut und populäre Gedichte und stellt fest, daß das gemeinsame Singen das Verbundheitsgefühl gestärkt und teil-weise erotische Züge getragen habe, obwohl er die Texte überwiegend als lyrischen Kitsch ansieht. Die Melancholie habe in gewisser Weise als Droge gewirkt. Textbeispiele verweisen in heldischem Pathos immer wieder in eine ferne Reiter- und Landsknechtvergangenheit. Todesahnungen, das unum-kehrbare „Vorwärts“ und Selbstaufopferung als „Gebet“ im Rahmen einer höheren geschichtlichen Logik stehen im Gegensatz zu traditionellen Soldatenliedern, die sich sentimental, aber doch konkret mit der Heimat und den Lieben befassen. Den Vorwurf des Präfaschismus, der insbesondere seit Ende der Sechzigerjahre erhoben wurde, hält der Autor nur für teilweise berechtigt, meint aber, daß man von mangelnder Rationalität und politischer Unreife sprechen müsse, die die Jugendgruppen 1933 praktisch widerstandslos zu den Nazis geführt habe. Die Jugendbewegung hat viele Stilelemente, Symbole, Begriffe und Umgangsformen „erfunden“, die vor allem männliche Jugendliche in die HJ lockten, aber noch nach 1945 und teilweise bis heute das Leben bündischer Gruppen bestimmen. Doch auch Widerstandsgruppen, wie die „Weiße Rose“ und der „Kreisauer Kreis“, sind nicht ohne bündische Wurzeln zu denken. Die männerbündischen Elemente werden von NS-Pädagogen weiterent-wickelt: es bedürfte der „Vereinigung freier Männer“, um nicht zum „Weiber-knecht“ oder „versimpelten Familienvater“ zu werden; die eigentliche emotionale Bindung des Mannes sei die bis zur Selbstaufopferung gehende Liebe zum eigenen Volk. Männerbundlieder werden übernommen, hinzu kommt das für die Nationalsozialisten typische Gemeinschaftslied. Zentrales Symbol wird die Fahne. Die männliche Jugend ist kämpferischer Vortrupp - „Treu leben, todtrotzend kämpfen, lachend sterben“ ist das Motto der Hitler-Jugend – die weibliche Jugend soll „bewahren“. Eine weitere Maxime lautet: „Deutscher Student, es ist nicht nötig, daß Du lebst, wohl aber, daß Du Deine Pflicht gegenüber Deinem Volk erfüllst“. Ein Kapitel behandelt eine Auswahl an Briefen, die deutsche Soldaten aus dem Kessel von Stalingrad geschrieben haben. Obwohl davon auszugehen ist, daß diese Männer als Soldaten den in sie gesetzten Erwartungen ent-sprachen, sprechen ihre Briefe von krasser Verzweiflung, der Hoffnung auf Gott und das Schicksal. Heroische Reflexionen fehlen völlig, „seine Pflicht tun“ bleibt einzige Sinnstiftung. Sehnsucht nach der Mutter als Gegenwelt zum Krieg überwiegt, selbst Ehefrauen werden in einer Art fürsorglicher Mutterrolle gesehen. Hatte Ernst Jünger 1922 geschrieben: „Kontakt mit Frauen entmannt den Soldaten und läßt Gefühle entstehen, die unvereinbar sind mit der Härte und Selbstentäußerung, die einen effektiven Kampf erst ermöglichen“ („In Stahlgewittern“), so sind die Briefe von der Ostfront weit von Hochgefühl und heroischer Selbstüberwindung entfernt. Nach 1945 sind ehemals sinnstiftende Begriffe, wie Vaterland, Ehre, Staat, Recht, Freiheit entwertet – das deutsche Volk ist heimatlos. Wie Oral-History-Studien der Fünfzigerjahre zeigen, knüpfen Werte, Normen und Umgangsformen wesentlich an die Maximen der Wilhelminischen Zeit bzw. der Zwanzigerjahre an. Der Lebensentwurf dieser Generation sieht vor allem den Ausbau der Privatwelt vor, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Dritten Reich mit Zügen einer Idealwelt ausgestattet wird. Daraus ent-wickelt sich die „skeptische Generation“: illusionslos, ohne Pathos - vor allem aber angepaßt. Die wiedererstandenen Wandergruppen knüpfen an die Tradition der Zeit vor dem Nationalsozialismus an, vor allem beim Gemeinschaftsleben der männ-lichen Jugend; selbst die archaisierende Sprache wird übernommen. Neu ist das politisch teilweise unangepaßte Engagement: Lieder von Brecht gehören zum Standardrepertoire, und seit den Fünfzigerjahren gibt es Ver-bindungen zur Ostermarsch- und Anti-Atomtod-Kampagne und gegen die deutsche Remilitarisierung. Doch sprechen Fahrtenberichte nach wie vor – oder wieder – davon „in herrischer Zucht, in Härte hart und ungebeugt“ dem Unbekannten zu trotzen. Die Lieder sind nun weniger trutzig und markig als melancholisch und elegisch, doch auch männerbündische Romantik aus den 20-er-Jahren lebt teilweise wieder auf („verlorener Haufen“ – Landsknechtromantik). Mitscherlich hat die „Vaterlosigkeit“ thematisiert: Ca. 22% der jungen Menschen haben ihre Väter im Krieg verloren, doch wird der Einfluß dieses Umstandes auf Mannwerdung und Männerbild kaum erörtert. Der Autor schließt mit den Sechzigerjahren, der Beschreibung der neuen Stilformen und der Erosion der Werte der Elterngeneration: Karrierestreben, Ordentlichkeit, Anständigkeit, Sauberkeit, Bescheidenheit, Pflichtbewußt-sein, etc., den Provokationen durch „Gammler“ und „Hippies“ und der „Entdeckung“ der NS-Vergangenheit als Beitrag zur „Ich-Archäologie“. Der Abdruck von drei Reden des Autors zum Thema Jugendbewegung rundet den Band ab. Wenn sich auch Reulecke auf die Beschreibung der Vereinigungen junger Männer in Deutschland vor dem Hintergrund des Wilhelminischen Kaiser-reichs bis in die Zeit von Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg und das Erstehen eines anderen Deutschland danach konzentriert, so stellt sich doch die Frage, ob dieses Bild nicht in vieler Hinsicht als typisch für große Teile Europas gelten kann. Eine Ausweitung der Untersuchung über die Jugendbewegungen hinaus bis zu Vereinigungen erwachsener Männer und den dahinterliegenden Ideolo-gien wäre interessant und wünschenswert, doch geht lediglich das Kapitel über letzte Briefe aus Stalingrad in diese Richtung. Obwohl das Buch in wissenschaftlichem Ton geschrieben ist, ist es niemals trocken oder lebens-fern. Man spürt das Engagement eines Menschen, der die Frage aufwirft, ob ein Historiker nicht immer auch seine eigene Geschichte schreibt. Der Vater des Autors verlor sein Leben in Stalingrad. |
||