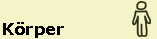
 |
WEBPORTAL:
MÄNNLICHKEITEN
|
||
| Start/Sozialisation/Krieg/Kowarsch-Wache | |||
|
|
Zitieren sie diesen Text bitte folgendermaßen: Kowarsch-Wache, Trude : Kriegstagebuch des Felix Wache. In: Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte der Universität Wien, http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/sozialisation/krieg_01.htm Kriegstagebuch des Felix Wache Felix Wache, geboren am 26. Oktober 1901 in Holics (nahe
Lundenburg, heute Slovakische Republik) als Sohn des Gutsverwalters der
kaiserlichen Besitzung am Ort. Vier ältere Schwestern, ein älterer
Bruder, 1917 gefallen. Reifezeugnis der Realschule in Brünn vom Juli
1920; Diplom der Hochschule für Welthandel in Wien vom März
1924. Eheschließung 1928; ich bin 1934 geboren und sollte das einzige
Kind bleiben. Mein Vater war ab 1938 im Staatsdienst, vorher in einem
Privatunternehmen tätig; nicht Nationalsozialist. Er beendete seine
Berufstätigkeit als Hofrat der Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich, Burgenland. Träger des Großen Ehrenzeichens;
1984 verstorben. Ich habe Erinnerungen an meine Großmutter, seine Mutter,
hauptsächlich allerdings an ihre physische Erscheinung, kein „Gefühl“
für ihr Wie-als-Mensch-Sein. Die Gefahr, die persönliche Nähe für Interpretation
bedeutet, ist mir bewußt; es gab jedoch kaum persönliche Nähe
zwischen uns, auch das verringert diese Gefahr. Die „Quelle“ ist ein Taschenkalender des Jahres 1935, in dem mein Vater seinen persönlichen Kriegsablauf, nach Jahren geordnet, beginnend mit der Eintragung vom 22/6. 1943: Wien ab 22.40, bis zur Notiz 10/8.45: an Wien 6h. festgehalten hat. Zwischen Beginn und Schluß geschieht in diesen Aufzeichnungen, die in kurzen Zeitabständen, teilweise täglich, erfolgten, nichts außer dürren Tatsachen. Es ist ein geographisch und zeitlich exakter Ablauf zwischen den zeitlichen Polen Juni 1943 und August 1945, eine minutiöse Schilderung der „Kriegswanderung“ meines Vaters; ich greife wahllos heraus, es betrifft das Jahr
Ein anderer Zeit- und Ortswechselablauf, gleich nach dem Abtransport aus Wien:
Die Zeit der Ausbildung in einer Wiener Kaserne ist, zumindest hier, nicht festgehalten. Die Suche nach persönlichen Spuren ist nicht aufwendig, es gibt sehr wenige. Sie beschränken sich auf gelegentliche Hinweise auf Essen und Zwischen-Durch-Aktivitäten.
Es gibt aber dennoch Hinweise auf Krieg und persönliche Gefährdung:
Ich greife die Stellen heraus, in denen mein Vater Heimaturlaub behandelt:
Der Heimaturlaub anläßlich Ableben und Begräbnis seiner Mutter wird beschrieben:
Mein Wissen über den Anlaß dieses Heimataufenthaltes entstammt einer dokumentarischen Quelle (Sterbeurkunde). Ein paar eher episodenhafte Vorkommnisse:
Wieviele Menschen tauchen auf?
Die Beschreibung der Gefangennahme:
Die Beschreibung der Heimkehr folgt der bisherigen Vorgangsweise: genaue Angaben über die Wegstrecke, Abfahrt- und Ankunftszeiten. Sie endet, wie schon beschrieben, mit:
Das hier beschriebene „Tagebuch“ umfaßt bei einem Größenausmaß von 8 mal 11,5 cm 41 Seiten; ich habe alle Stellen, die sich dem Ablauf der Beschreibung von Wegzeiten und Ortsveränderungen entziehen, erfaßt. Erklärung zur Bedeutung von „einladen“, „verladen“: Mein Vater war, wie bereits erwähnt, in einem Sanitätsbataillon; es handelt sich also um Transporte von Verwundeten. Hier tut sich eine neue Quelle von Information für mich auf: Mein Vater hielt zu vier ehemaligen Kriegskameraden bis in eine sehr späte Lebensphase aller Beteiligten Kontakte aufrecht; die Familien trafen sich regelmäßig; es gab gemeinsame Urlaubsreisen. Es war das der einzige Freundeskreis meines Vaters, den ich kannte – ich weiß nichts von seiner Jugendzeit - ; auf diesem Umweg habe ich manches erfahren. Diese Treffen waren durchaus dem Gedenken gemeinsamer Erfahrungen gewidmet, verständlicherweise ein starkes Band, anscheinend eines, das die konstruierte Autonomie durchbricht. Selbst in diesem engen Kreis, der mit Sicherheit Erinnerungen teilte, die Lebensgewißheiten veränderten, kamen ausschließlich die gefilterten und vom Schmerz bereinigten „Randbanalitäten“ zur Sprache. Ich möchte aber hier keine Verbindung zu einem soziologischen Männerbild herstellen, das Phänomen scheint eher psychologischer Natur, Umgang mit teils traumatischen Krisenerlebnissen, zu sein. Die bearbeitete Quelle belegt nur eine Lebenssituation und nur einen Lebensabschnitt meines Vaters, sie scheint mir dennoch das von Böhnisch/Winter erarbeitete Konzept fast vollständig abzudecken. Ich setzte dabei allerdings voraus, dass „Gewalt“ nicht nur physische meint, Gewalt mentaler Art spiegelt sich deutlich in der Eintragung unter dem 6/11.1944 des „Kriegsreisetagebuches“ wider. Zum besseren Verständnis eine genaue Wiedergabe der Stelle:
Eindeutig nicht zur Sprache – oder zur Schrift – kommt das Thema Frauen, ich sehe aber gerade in diesem Fehlen eine starke Präsenz. Ich begebe mich auf unwissenschaftliches Gebiet und trage aus Erinnerungen nach: mein Vater sprach von meiner Mutter nie als von „meiner Frau“, die absolut gängige Benennung für Ehefrau, sondern immer nur als von „der Frau“, den Artikel benützend, und es klang keineswegs nach der Frau, der einzig möglichen. Gebote oder Verbote meines Vaters, mich betreffend, erreichten mich ausschließlich über meine Mutter. Ich stelle nun das von Lothar Böhnisch und Reinhard
Winter erarbeitete Modell männlicher Sozialisation vor. Autonomie ist derjenige Zustand der Integration, in dem ein Mensch in voller Übereinstimmung mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen ist. Autonomie beinhaltet die Fähigkeit, ein Selbst zu haben, das auf den Zugang zu eigenen Gefühlen und Bedürfnissen gründet.(2) Böhnisch/Winter zitieren hier Gruen 1986,95, 17. Obwohl (oder weil) Gruens Autonomiebegriff keine Konnotion
mit soziologischen Konzepten hat, wird der Gedanke über „Lebensbewältigung“
zu „Bewältigung des Mannseins“ weitergeführt; es
werden Bewältigungsmuster männlicher Sozialisation und deren
Prinzipien erarbeitet und in Punkten gegliedert (Erwähnung oben): Gewalt als wesentliche Konsequenz der
Externalisierung, a u c h in der Benutzung, mit der Gewalt teils verbunden, bedeutet zumeist Abwertung Anderer. Stummheit, nicht auf Sach-, aber auf persönliche
Themen zu beziehen; diese sind nicht Alleinsein, korrespondierend mit Stummheit, uns in der Erscheinungsform des „einsamen Wolfes“ vertraut. Körperferne, sie hat a u c h den Aspekt der Funktionalisierung und Objektivierung der Frau und der Distanz zum eigenen Körper. Rationalität, der Externalisierung verwandt, rückt Emotionalität ins Abseits. Kontrolle der Anderen und des Selbst, im zweiten Fall a u c h zur Aufrechterhaltung der vorgenannten Prinzipien. Aus meiner Sicht deckt sich die von mir vorgestellte Quelle,
so geringfügig wie möglich durch Anmerkungen ergänzt, weitgehend
mit dem Modell männlicher Sozialisation nach dem Entwurf Böhnisch/Winter.
Literatur & Anmerkungen: (1) Böhnisch, Lothar/Winter, Reinhard, Männliche Sozialisation. Bewältigungsprobleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf. Weinheim 1993. (2) Gruen, A.: Der Verrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau. München 1992. |
||