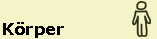
 |
WEBPORTAL:
MÄNNLICHKEITEN
|
||
| Start/Rollen/Familie | |||
|
|
Zitieren sie diesen Text bitte folgendermaßen: Sycha, Roswitha: Essay; Der "neue" Mann - Männer im Wandel. In: Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte der Universität Wien, http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/rollen/familie_02.htm Der „neue“ Mann – Männer im Wandel
Historischer Rückblick Wenn wir uns mit dem Schlagwort „neuer Mann“ beschäftigen, müssen wir uns auch ein bisschen mit der Geschichte der Männlichkeit befassen. Denn gerade die geschichtliche Entwicklung prägte unser Bild vom Mann und von der Frau ( welche wir in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen dürfen). Das Bild des Mannes ist nicht unveränderlich, noch nicht einmal einheitlich. In der Regel gibt es mehrere „Männlichkeiten“, die untereinander in einem hierarchischen Verhältnis stehen und um Hegemonie streiten. Das, was heute unter „Männlichkeit“ verstanden wird, ist historisch recht jung, und in seiner Entstehungsgeschichte eng verknüpft mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft. Männlichkeit(en) können aber auch nicht ohne Weiblichkeit(en) gedacht werden, die verstärkt als das Gegenstück zu Männlichkeit konstruiert wird. Interessanterweise wurden bis etwa zur ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Mann und Frau gerade in biologischer Hinsicht als ähnlich gesehen, wobei „Mann“ die Norm und „Frau“ die Abweichung von der Norm darstellte. Erst mit dem Entstehen einer weiblichen „Sonderanthropologie“ kam es zu einem Diskurs über die geschlechtliche Natur des Mannes und der Frau. Ein Konzept qualitativer und gegensätzlicher Charaktere entstand. Diese Konstruktion von Gegensätzen wirkte sich auch maßgebend auf die Arbeits- und Machtteilung aus. So kam es zu einem Ausschluss der Frauen aus dem öffentlichen Bereich und deren Einschluss in die häusliche Sphäre. Es folgte eine allmähliche Trennung von Erwerbsarbeit und Familien – bzw. Hausarbeit. Die „Natur“ diente also als Rechtfertigungsgrundlage für die bürgerliche Gesellschaftsordnung und bis heute ist diese Argumentationslinie oftmals Grundlage der Geschlechterdiskurse. Was versteht man nun unter „Männlichkeit“? Diese Frage ist sicher nicht einfach und eindeutig zu beantworten.
Robert Connell versteht darunter „ eine Position im Geschlechterverhältnis;
die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einnehmen,
und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung,
auf Persönlichkeit und Kultur.“ Es gibt keine universell gleiche
Männlichkeit und sie ist nicht natürlich vorgegeben. Männlichkeit
in unserer Gesellschaft wird meist als die überlegenere Position
gesehen und oft noch verstanden als Ausübung von Macht und Kontrolle,
Stärke, Disziplin, Logik, Rationalität, Härte, Erfolg,
Ehrgeiz und Besitz. Weiblichkeit wird assoziiert mit Schwäche, Unterwerfung,
Unsicherheit, Gefühl, Intuition, Nachgiebigkeit, Häuslichkeit,
Rücksicht und Liebe. Gelten diese aufgestellten Zuschreibungen noch?
Oder kam Bewegung in die Rollenbilder? Nach dem zweiten Weltkrieg begann
schön langsam das Aufbrechen von hegemonialen Männlichkeitsstrukturen
und um 1970 kam es zur Auflösung des hegemonialen Männlichkeitskonzepts,
welches immerhin die Gesellschaft ungefähr hundertfünfzig Jahre
prägte. Neue Männlichkeitstypen entstanden wie zum Beispiel
der „Softy“, der „Typ des neuen Vaters“ (der wieder
zu Hause anwesende Vater) oder der „Typ des Partners“. Wurden
diese „neuen Typen“ auch von den Männern angenommen?
Oder stellten sie nur Idealbilder dar über die man diskutierte, deren
Durchsetzung aber nicht so einfach möglich war? Dieser Diskurs war
sicher ein wichtiger Schritt, weil doch etwas Bewegung in die Welt der
Männer kam. Männer hatten nun auch die Möglichkeit aus
dem vorgegebenen Männlichkeitsideal auszubrechen und eine andere
Position einzunehmen. Das war sicher sehr schwierig und es gab nur wenige,
die den Mut und die Kraft dazu hatten. Die öffentliche Diskussion
war wichtig, denn immer mehr Männer und Frauen begannen über
sich und ihre Rolle in der Gesellschaft nach zu denken und dies nicht
mehr allein zu Hause bei verschlossenen Türen. Wo stehen wir Heute? Gibt es einen „neuen Mann“? Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Entwicklungsprozess,
der sicher noch nicht abgeschlossen ist. 1998 wurde eine empirische Studie
„Männer im Aufbruch“ unter 1200 Männern und 800
Frauen in Deutschland durchgeführt. Die Resultate dieser Untersuchung
geben, meiner Meinung nach, einen kleinen Einblick, wie Mann sich sieht.
Vielleicht kann man dieser Studie mangelnde Aktualität vorwerfen,
aber sie zeigt Tendenzen, welche auch noch heute gelten. Zwanzig Prozent
der befragten Männer konnten der Kategorie „neuen Männer“
zugeordnet werden. Der Tendenz nach befinden sie sich in den Altersklassen
der 30- bis 50-Jährigen und sind eher Freiberuflichen, Angestellte
und Berufslosen (Studenten, Arbeitslose) zuzurechnen. Sie gaben eine deutliche
Bereitschaft zu einer Veränderung des Rollenverhältnisses zum
Ausdruck. Sie denken über sich selbst nach, bekennen sich zum Wandel
ihres Selbst-Verständnisses und sind bestrebt, ein offeneres Verhältnis
zu anderen Männern zu entwickeln. Sie lassen emotionale und soziale
Kompetenz erkennen, haben mehr Fühlung zu ihrer Innenwelt und sind
sexuell freier und zufriedener. Die neuen Männer sehen im Erziehungsurlaub
eine Bereicherung und beteiligen sich aktiver an der Erziehung. Die Emanzipation
der Frauen ist ihnen ein Anliegen und sie unterstützen ihre Partnerinnen
darin. Den Beruf halten sie nicht mehr für so wichtig im Männerleben,
aber trotz allem bleibt die Erwerbsarbeit für das männliche
Selbstwertgefühl zentral (nach eigener Einschätzung der Befragten).
Sie versichern ihre Bereitschaft für eine gerechte Verteilung von
Haus- und Erwerbsarbeit und bekunden ihre Offenheit für einen Wandel
der traditionellen innerfamiliären Arbeitsteilung. Doch aller Bereitschaft
zum Trotz: Die Realität spricht oft eine andere Sprache, wie die
Aussagen der im Rahmen der Untersuchung befragten weiblichen Kontrollgruppe
verdeutlichen. Die Männerselbstsicht und die Männermeinung mit
den Augen der Frauen differieren teilweise beträchtlich. Nach Einschätzung
der Frauen haben auch die neuen Männer Schwierigkeiten, alte Regeln
und Werte des Mann- Seins über Bord zu werfen. Das betrifft vor allem
die Rolle des Mannes im Familienalltag. So bleibt das häusliche Engagement
der neuen Männer des öfteren hinter den Erwartungen der Frauen
zurück und reduziert sich gewöhnlich auf die „sauberen
Aktivitäten“ (Sport und Spiel mit den Kindern) oder bleibt
auf rein „männliche Arbeitsbereiche“ (Reparaturen, Autopflege,
etc.) begrenzt. Die eher „schmutzigen Arbeiten“ ( Wohnung
putzen, Wäsche waschen und bügeln, etc.) werden weitgehend ignoriert.
Fazit: das Selbstbild der „neuen“ Männer deckt sich nicht
ganz mit dem Bild der „neuen Männer“ aus der Sicht der
Frauen. In den vorangegangenen Zeilen habe ich versucht deutlich zu machen, dass unsere Gesellschaft in einem Entwicklungs- und Umdenkprozess steht, dass sich einfach etwas bewegt. Männer beginnen mehr über sich und ihre tradierten Rollen nachzudenken. Sie sind offener zu sich und gegenüber anderen und sie müssen lernen, dass es verschiedenste Lebensziele und Lebensmöglichkeiten gibt. Ich habe auch versucht zu zeigen, dass es nicht sehr leicht ist, das alte Rollenbild abzulegen, weil dafür die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ( Abkommen vom weitverbreiteten männlichen Alleinverdienermodell, flexiblere und Verringerung der Arbeitszeiten, etc. ) nicht wirklich gegeben sind. Den wirklich „neuen“ Mann gibt es meiner Meinung nach noch nicht. Die Entwicklung ist im Gange. Was gesellschaftlich akzeptiert wird, das Spektrum von Männlichkeit und auch von Weiblichkeit, ist breiter geworden.
|
||