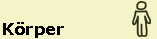
 |
WEBPORTAL:
MÄNNLICHKEITEN
|
||
| Start/Rezensionen/Rolle/North | |||
|
|
Zitieren sie diesen Text bitte folgendermaßen: North, Marie : Rezension von "Die Verräter". In: Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte der Universität Wien, http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/rezensionen/verraeter_01.htm Verortung einer Quelle Einleitung Die vorliegende Arbeit stellt meinen ersten Versuch dar, eine Quelle zu beschreiben. In dem Text geht es weniger darum konkrete Fragen an die Quelle zu stellen, als ihr Potential als Forschungsgegenstand für Männergeschichte zu eruieren. Die Quelle und ihre Verortung - Ein Ratgeber Die Verräter: Zwei Männer enthüllen die letzten
55 Geheimnisse ihrer Art von Harald Braun und Christian Sobiella. Kreuzlingen
/ München: Heinrich Hugendubel Verlag, 2002, 267 S. Gebunden 15,95
€ Der Inhalt Das Werk soll, so hat es den Anschein, in erster Linie unterhalten. Mit anderen Worten im Fokus steht das gängige Klischee
vom Mann, welcher Fußball verehrt, dem die Karriere wichtiger ist
als die Familie, der sich bekochen lässt und viel zu wenig auf die
Probleme einer Frau (vorzüglich seiner Lebenspartnerin) eingeht.
Der Text ist humorvoll, flüssig und leicht geschrieben, und die Autoren pflegen einen sehr informellen und persönlichen Schreibstil. Die Autoren scheinen sich über ihr eigenes Geschlecht lustig zu machen, zur Unterlegung dieser Annahme ein Auszug aus dem Prolog: Warum es dieses Buch gibt wollen sie wissen? Na ja, da kommt einiges zusammen. Geltungssucht natürlich, unverbrämte, hemmungslose Eitelkeit. Weiterhin die Möglichkeit, mal an prominenter Stelle seine Meinung in die Welt zu blöken, die dann für einen trügerischen Moment ein kleines bisschen maßgeblicher erscheint. Sicher der Umstand, dass wir schon lange mit Jungs zu tun haben und wissen, wie lächerlich und merkwürdig diese Gestalten sein können – genau wie wir beide übrigens. Die Autoren Der Biographien der Autoren wird leider wenig Aufmerksamkeit
geschenkt, es wird nur kurz im Umschlagtext ihre Ausbildungs- bzw. Berufslaufbahn
dargestellt. Beide sind oder waren schreibend für Frauenzeitschriften
tätig. Ihr Potential als Forschungsgegenstand - Der Inhalt unter der Lupe
In einem anderen Abschnitt des Buches, worin es um das Thema Kochen geht, wird festgehalten, dass Frauen besser kochen, weil sie sich auf ihr intuitives Gefühl verlassen können, denn sie haben laut Ernährungswissenschaftlern feinere Geschmacksnerven als Männer. Eine Untermauerung der getätigten Aussagen durch Heranziehung von Fachwissen, wie im vorangegangenen Beispiel, ist allerdings eine Seltenheit. Im Kapitel Steht mir das? wird der Frage nachgegangen, warum
Frauen beim Einkaufen (vornehmlich beim Einkaufen von Kleidungsstücken)
sich überdurchschnittlich mehr Zeit nehmen als Männer. Fazit
der Autoren: Männer wählen, im Gegensatz zu Frauen, ihre Klamotten
schneller aus, weil sie nach den Kriterien der Tragbarkeit und Funktionalität
vorgehen. Das Konfuse an der vorliegenden Quelle ist, dass teilweise
Verhaltensweisen des Mannes, welche dem gängigen Klischee entsprechen,
festgehalten werden, ohne dass, auf die Gründe hingewiesen wird,
wieso diese Verhaltensweisen für Männer angeblich so charakteristisch
sind. Die verschiedenen Aspekte des männlichen Verhaltens werden
als unveränderliche Dogmen hingestellt, auf eine Begründung
wird meistens verzichtet. Hier ein Beispiel aus dem Kapitel: Reine Selbsterhaltung? Warum Männer Schweine sind. Man kann sicher sein, dass Männer nicht als Ferkel geboren werden. Warum werden sie dann welche? Sozialisation heißt das Zauberwort. Und die beginnt früh. Männer werden bereits am Erfolg gemessen, wenn sie noch Kinder sind. Das macht Druck. Erfolgsdruck. Und Erfolg hat man, wenn man weiß, was man will, nicht nach links oder rechts schaut, sondern geradeaus seinen Weg sucht, die Ellbogen ausfährt und sich nicht den Luxus gönnt, sein Verhalten kritisch zu hinterfragen. Ob die Begründungen für das Verhalten von Männern richtig oder falsch sind, soll an dieser Stelle nicht im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Gedanken zu einem Klischee Bei der Beschreibung des Verhaltenskodex des „0815“- Mannes wird nur selten auf den Aspekt hingedeutet, dass womöglich Verhaltensweisen und Rollenverhalten nicht von Geburt an vorhanden sind, sondern auf Sozialisation, Erziehung bzw. auf eine kulturelle Konstruktion eines Männerbildes gestützt sind. In der Mehrzahl der Kapitel in diesem Buch wird die Andersartigkeit des Mannes, mit den Attributen, die dem Klischee entsprechen, unterstellt, ohne näher auf die Ursprünge der beschriebenen Vorurteile einzugehen. Es wird ein Klischee breitgetreten, dass jeder kennt, dessen Überzeichnung und Falschheit sich der Mensch theoretisch bewusst ist, er es in der Realität / in der Praxis dennoch gerne als Argumentationsmuster heranzieht! Das Problem an einem Klischee ist folgendes, denkt man/frau ein, zwei Kriterien eines Vorurteils oberflächlich in einem Menschen erkannt zu haben, meint man/frau das gesamte Klischee, welches aus wesentlich mehr Mosaiksteinchen zusammengesetzt ist, als bestätigt! Als Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung in Hinblick
auf Männlichkeitsgeschichte, gewinnt der Ratgeber an Potential. Einige Gedanken zum Bezug der Quelle zur Männergeschichte Die Stärke des Buches liegt darin, dass es das vorhandene klischeehafte Männlichkeitsbild von 2002 aufzeigt – eine Momentaufnahme. Die einzelnen Bruchstücke dieses Bildes, auf deren Ursprünge im Buch nicht hingewiesen wird, sind weiterhin im 19. und 20.Jhr. verwurzelt, was die (Forschungs-)Frage aufkommen lässt, ob es mit den gesellschaftlichen Veränderungen, beispielsweise durch eine Frauenbewegung und Emanzipationswelle, welche verstärkt am Ende der 60er Jahre zum Ausdruck kamen, wirklich etwas auf sich hat? Ein Impuls, der in Die Verräter geliefert wird, ist die Aussage, dass Männer sich leicht orientierungslos in dieser westlichen Gesellschaft (vornehmlich Deutschland) bewegen, da einerseits die Emanzipation der Frau teilweise bereits Fuß gefasst hat, beziehungsweise theoretisch schon lange ein Thema des öffentlichen Interesses darstellt, sich praktisch aber immer noch diese Emanzipation, oder die angebliche Wandlung des Männlichkeitsbildes weg vom patriarchalischem öffentlichem Manifest in etwas anderes, nicht immer wahrnehmbar ist. So ist es in Deutschland zwar möglich als Mann in Karenz zu gehen, aber wirtschaftlich nicht ratsam, und da die meisten Familieneinkommen, auf den Einkommensteil des Mannes mehr angewiesen sind als auf den der Frau, geht die Frau in Karenz. Natürlich spielen bei dieser Entscheidung auch andere Faktoren eine Rolle, wie z.B., dass die Mutterrolle meistens ausschließlich der Frau, auch von Frauen selbst, zuerkannt wird. Zur Orientierungslosigkeit der Männer George L. Mosse geht in seinem Werk Das Bild des Mannes
einem maskulinen Stereotyp nach, dessen Ursprünge er im 18.Jhr. sucht
und welches in der 1. Hälfte des 20.Jhr. wahrscheinlich seinen jüngsten
Höhepunkt erlebt hat! Es handelt sich dabei um die Entstehung eines
ausgeklügelten Regelwerks, das hilft ein richtiger Mann zu werden,
bzw. einen solchen zu erkennen. Mosse geht unter anderem der Frage nach, ob dieses Männlichkeitsbild, dass seiner Meinung nach, in den Jahrhunderten zuvor, zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft gedient hat und in der 1. Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Normen für die Gesellschaft festgelegt hat, heute noch Gültigkeit hat, bzw. für das Bestehen der Gesellschaft von Notwendigkeit ist? Laut Mosse kam es in der 2. H. des 20.Jhr. zu einer Aushöhlung
des männlichen Stereotyps, dessen formale Charakteristika bestehen
bleiben, man sich aber von den früher damit verbundenen Werten der
Männlichkeit verabschiedet. Conclusio Um noch einmal kurz zum Punkt zu kommen, diese Quelle bietet
ein Standbild des männlichen Klischees 2002. In diesem wird die Allgemeinheit
der männlichen Bevölkerung auf einen Nenner reduziert.
www.univie.ac.at/igl.geschichte/ws2002-2003/Maennlichkeiten.doc Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. Harald Braun/Christian Sobiella, Die Verräter, Kreuzlingen / München: Heinrich Hugendubel Verlag, 2002 |
||