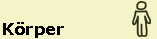|
| |
|
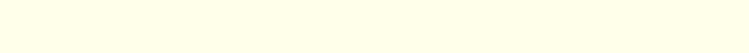
Zitieren sie diesen Text bitte folgendermaßen:
Luef, Evelyne:
Rezension von Rebekka Habermas:
Frauen und Männer des Bürgertums. In: Webportal für die
Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte der
Universität Wien,
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/rezensionen/habermas_01.htm
Rebekka Habermas
Frauen und Männer des
Bürgertums
Mit ihrem Buch "Frauen und Männer des
Bürgertums" ermöglicht Rebekka Habermas einen Einblick
in die Alltags- und Mentalitätsgeschichte des Bürgertums um
1800. Bei dem hier vorliegenden Werk handelt es sich um eine gekürzte
Ausgabe ihrer 1997 entstandenen Habilitationsschrift. Ihre Arbeit basiert
auf einer großen Zahl von Ego- Dokumenten wie z.B. Briefe, Tagebücher,
Testamente, autobiographische Fragmente und Stammbücher, aus dem
Nürnberger Stadtarchiv. Diese Dokumente stammen aus dem Nachlaß
zweier miteinander verschwägerter Bürgerfamilien. Dabei handelt
es sich um die Familie Merkel aus Nürnberg, Kaufleute mit erheblichem
politischen Einfluß, und die Familie Roth aus Stuttgart, eine
Familie von Beamten, Pfarrern und Lehrern, die dem deutschen Bildungsbürgertum
angehört. Habermas untersucht diese beiden Familien für den
Zeitraum von circa 1750 bis 1850. Dabei ist nicht nur die Analyse einer
Familie über zwei Generationen hinweg interessant, sondern auch
die Vernetzung zweier verschiedener Bürgertümer, dem Bildungsbürgertum
und dem Wirtschaftsbürgertum. Die Autorin konzentriert sich in
ihrer Untersuchung auf drei zentrale Bereiche des bürgerlichen
Alltagslebens, nämlich Arbeit, die verschiedenen Formen der Geselligkeit
und das Zusammenleben in der Familie. Rebekka Habermas versucht dabei,
dem Titel ihres Werkes entsprechend, jeweils Frauen und Männer
gleichgewichtig und aufeinander bezogen zu behandeln. Dadurch will sie
Unterschiede zwischen theoretischen Normen und Werten der bürgerlichen
Lebensführung und der praktischen Umsetzung, dem täglichen
Handeln aufzeigen. Ihr Ziel ist es zu zeigen, daß das Bürgertum
durchaus nicht so homogen war wie häufig angenommen, sondern vielfältige
bürgerliche Lebensformen möglich waren. Weiters versucht sie
verschiedene, bisher vorherrschende Thesen wie z.B. die Vorstellung,
daß das eheliche Verhältnis einer Beziehung zwischen Oberhaupt
und Untertan glich, oder die Trennung der weiblichen und männlichen
Räume zu widerlegen. All diese Vorstellungen deklariert Habermas
als revisionsbedürftig.
Im ersten Kapitel beschäftigt sich Habermas mit den Tätigkeitsbereichen
und Arbeitseinstellungen der Frauen und Männer beider Generationen.
Die Ausführungen darüber sind jedoch keine abstrakten Erklärungen
sondern detaillierte Angaben zu konkreten Arbeitsprozessen. Die Autorin
informiert bis ins Detail über Haushaltsführung, Gemüseanbau
und vieles mehr. Sie kann zeigen, daß in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts die Auseinanderentwicklung von weiblicher und männlicher
Arbeitswelt keineswegs so dramatisch verlief wie bisher angenommen.
So zeigt Habermas zum Beispiel, daß die Hausarbeit in dem untersuchten
Zeitraum beide Generationen von Frauen in etwa gleich belastete, also
beinahe gleich blieb, die Einstellung zu dieser Arbeit sich allerdings
veränderte.
Im zweiten Teil wendet sich die Autorin gegen die scharfe Differenzierung
in eine öffentlich- männliche und eine privat- weibliche Gesellschaftssphäre.
Sie vertritt die Ansicht, daß die Geselligkeitsformen wesentlich
vielschichtiger waren als bisher angenommen. So wenden die Merkels für
die sozusagen "geschlechterübergreifende" häusliche
Geselligkeit mindestens ebensoviel Zeit auf wie für die Vereinstätigkeit.
Bei solchen Veranstaltungen im privaten Raum diskutierte man mit Freunden
sowohl über aktuelle Themen, Politik, Kunst und Literatur als auch
über familiäre Dinge. Daran waren Mann und Frau gleichsam
beteiligt und traten als Paar auf. Den rein männlichen Logen, Vereinen
und Lesekabinetten, von denen Frauen zunächst ausgeschlossen waren,
standen weibliche Gegenveranstaltungen wie der Wohltätigkeitsverein
oder "Kränzchen" gegenüber.
Im dritten und letzten Teil widmet sich Habermas noch dem Bereich Familie
und Eheleben. Hier kommt die Autorin zu dem Schluß, daß
in der Praxis immer noch ökonomische Faktoren für die Eheschließung
ausschlaggebend waren. Bei ihrer Analyse weist sie jedoch schon auf
eine deutliche Emotionalisierung der Ehe hin, so daß materielle
Interessen und eine sich entwickelnde Zuneigung zum Partner nicht automatisch
einen Widerspruch darstellten. Die Erziehung der Kinder nahm innerhalb
der Ehe einen besonders hohen Stellenwert ein. An dem Erziehungsprozeß
beteiligten sich beide Elternteile, wenn auch die Aufgabengebiete unter
den Ehepartnern, den Geschlechterrollen gemäß, aufgeteilt
wurden.
Rebekka Habermas hat sich in ihrer Studie im Besonderen mit drei Bereichen
auseinandergesetzt, auf die nun kurz eingegangen wurde. So eine Auswahl
ist durchaus notwendig und auch zulässig. Ganz besonders dann,
wenn man sich, so wie Rebekka Habermas es tut, bis in den "hintersten
Winkel" des Quellenmaterials vorwagt. Darüber hinaus darf
man allerdings nicht unberücksichtigt lassen, daß durch die
Ausblendung gewisser Lebensbereiche, wie z.B. Politik oder Religion,
manche Strukturen oder Verhaltensweisen nicht zutage treten, nicht sichtbar
werden können.
Rebekka Habermas gründet ihre Studie auf einen sehr umfassenden
Quellenstand, der eine dichte mikrohistorische Beschreibung der untersuchten
Familien ermöglicht. Viele ihrer Erkenntnisse gewinnt Habermas
durch den Vergleich der beiden Generationen. Der Generationenbegriff
bezieht sich zunächst ganz konkret auf die untersuchten Familien
und versteht in diesem Zusammenhang die Abfolge der Eltern und Kinder,
doch wird er zugleich auch immer wieder allgemein verwendet und meint
dann einen ganzen Gesellschaftsprozeß. Das hat zur Folge, daß
teilweise sehr weitreichende, verallgemeinernde Aussagen von diesem,
konkret die Familien Merkel und Roth betreffenden Material, abgeleitet
werden. Dadurch wird die Frage, was nun generell verallgemeinerbar ist
und welche Besonderheiten sich auf die untersuchten Familien beziehen,
nicht geklärt.
Grundsätzlich ist noch einmal zu betonen, daß die detaillierte
mikrohistorische Beschreibung dem Leser/ der Leserin sehr gute Einblicke
in das Leben der behandelten Personen ermöglicht. Aufgrund des
umfangreichen Quellenbestandes ist das Werk sehr anschaulich und lebendig
gestaltet und daher auch für ein nicht wissenschaftliches Publikum
interessant. Auch wenn die zeitspezifischen Lebensformen, Arbeitsweisen
und Grenzen der Geschlechterrollen nicht zu übersehen sind, vermittelt
die Autorin dennoch ein sehr modern anmutendes Bild der Geschlechterverhältnisse.
Die dargestellten Personen wirken überaus sympathisch und harmonisch.
Äußerst positiv zu bewerten ist, daß Habermas ihrem
eigenen Anspruch, Geschlecht als relationale Kategorie zu verstehen,
die sich in einem stetigen Prozeß der Veränderung befindet,
treu bleibt. Es gelingt ihr tatsächlich, stets beide Geschlechter
im Blickfeld zu haben und somit ein sehr ausgewogenes Bild zu präsentieren.
Rebekka Habermas räumt mit klischeehaften Vorstellungen auf und
zeigt die bürgerliche Gesellschaft wesentlich vielfältiger
und nuancierter als es bisher der Fall gewesen ist. In ihrem Werk wird
die häufig beschworene "männliche Exklusivität"
des Bürgertums aufgebrochen und der Lebewelt der bürgerlichen
Frauen gegenübergestellt.
In den letzten Jahren wurde von verschiedenen Seiten, sei es Frauenforschung
oder historischer Sozialwissenschaft, versucht mit klischeehaften Vorstellungen
aufzuräumen. Rebekka Habermas leistet mit dieser mikrohistorischen
Studie einen wichtigen Beitrag.
Literatur:
Habermas, Rebekka: Frauen und Männer des Bürgertums.
Eine Familiengeschichte (1750- 1850), in: Bürgertum; Beiträge
zur europäischen Gesellschaftsgeschichte14, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen , 2000
|