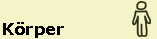|
| |
|
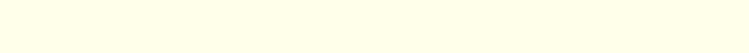
Zitieren sie diesen Text
bitte folgendermaßen:
Grabenschweiger, Andreas:
Rezension von Gottschalchs "Männlichkeit
und Gewalt". In: Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten
des Instituts für Geschichte der Universität Wien,
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/mentales/gewalt_01.htm
Rezension von Wilfried Gottschalchs
"Männlichkeit und Gewalt"
Wilfried Gottschalch fragt sich im vorliegenden Buch entgegen der mehr
oder weniger allgemein vorherrschenden Meinung, ob Männlichkeit und
Gewalt tatsächlich so eindeutig miteinander identifiziert werden
können. Als Ausgangspunkt für seine Betrachtungen des Themas
stellt er zwei Hypothesen auf: Erstens, der Hintergrund der Männlichkeit
ist weiblich. Zweitens, die Gewalt hat ein Janusgesicht, sie zeigt einmal
männliche, ein andermal weibliche Züge.
Inhaltlich ist das Buch ist in drei große Sektionen eingeteilt:
„Die Landkarte“ (Kapitel 1-3), „Unterwegs. Gewalt im
Lebensgang“ (Kapitel 4-12) und „Zum Beschluss“ (Kapitel
13).
Im ersten Abschnitt „Die Landkarte“ widmet sich Gottschalch
zunächst den verschiedenen Bedeutungen der zwei Kernwörter.
In Kapitel 1 verweist er darauf, dass der Begriff der Gewalt nicht nur
negativ besetzt sein muss; sie kann ebenso freundlich und schützend
sein. Oft werde sie auch mit Kraft und Macht gleichgesetzt, ferner mit
der Aggression. In Hinblick auf letzteres allerdings trifft der Autor
eine Differenzierung, denn für ihn hat die Gewalt, in der man „ruhen“
kann, eine eher statische Komponente, während er die Aggression als
dynamisch ansieht. Die Gewalt hänge somit eher mit der Soziologie
zusammen, die affekt- bzw. triebbestimmte Aggression mit der Psychologie.
Drei Arten von Gewalt unterscheidet Gottschalch voneinander: Physische
Gewalt, wie sie uns in der Alltagssprache begegnet; psychische Gewalt,
die nicht so augenscheinlich sei aber letztlich zu ersterer führe;
strukturelle Gewalt, die sich allerdings nicht in der Form Mensch gegen
Mensch äußert, sondern indirekt durch gewisse gesellschaftliche,
ökonomische oder kulturelle Gegebenheiten. Physische Gewalt brauche
als Voraussetzung körperliche Überlegenheit über das Opfer,
wogegen physische oft das Mittel der Schwachen sei.
Im zweiten Kapitel geht der Autor auf den Männlichkeitsbegriff ein.
Das Wort „Mann“ meint laut dem Deutschen Wörterbuch der
Gebrüder Grimm zwar zuerst „den Menschen ohne Berücksichtigung
des Geschlechts“, weist aber dann doch auf den Mann und seine ihn
gegenüber der Frau hervorhebenden Eigenschaften hin. Obwohl man im
täglichen Leben zahlreichen „Mischformen“ begegnet, also
Männer und Frauen mit unterschiedlich stark ausgeprägten männlichen
und weiblichen Zügen, bestehen in unserer patriarchalischen Gesellschaft
zahlreiche, historisch bedingte geschlechtsspezifische Zuschreibungen:
Männlichkeit wird mit Außen, Produktion, Arbeitswelt, Härte
und Distanz assoziiert, Weiblichkeit mit Innen, Konsumtion, Familie, Solidarität
und Intimität. Grob gesagt stehe Männlichkeit also für
das Aktive, Weiblichkeit für das Passive; ein Grund weshalb beide
Geschlechter die Weiblichkeit ablehnten. Die Frauen einerseits, oft enttäuscht
wegen der mangelnden Gleichstellung der Geschlechter, identifizieren sich
mit den Männern und blicken auf typisch weibliche Aufgaben wie Haushalt
und Kindererziehung herab; die Männer andererseits verleugnen und
fürchten oft ihre als unmännlich angesehenen weiblichen Seiten,
was zur Gewalt als Mittel zur sexuellen Befriedigung führen kann.
In Kapitel 3 wendet sich der Autor den methodischen Problemen seiner Untersuchung
zu. Um den Fehler der einseitigen Betrachtung zu vermeiden, bedient er
sich der sogenannten komplementaristischen Methode nach Georges Devereux.
Dieser hielt für die Analyse menschlicher Phänomene einen „doppelten
Diskurs“ für nötig, d.h. eine Erklärung in zwei Bezugssystemen.
Gottschalch verwendet demnach für die Erforschung sozialer Konflikte
die Soziologie, für innere Konflikte die Psychoanalyse, da beide
die Wechselwirkung zwischen Umwelt und Individuum widerspiegeln.
Mit dem zweiten, umfangreichsten Abschnitt des Buches, „Unterwegs.
Gewalt im Lebensgang“, beginnen die eigentlichen Betrachtungen von
Männlichkeit und Gewalt. In Kapitel 4, „Mutter und Sohn“,
widmet sich Gottschalch der Ambivalenz, die das Kleinkind gegenüber
seiner Mutter zeigt. Ein pränatales Seelenleben vorausgesetzt, entwickelt
das Neugeborene schon beim Geburtsakt den „Urhass“, da es
von der Mutter aus dem sicheren, warmen Uterus in einen unbehaglichen
Zustand entlassen wird. Es werde also auf Grund der nun erlittenen Not,
die sich beispielsweise in Angst, erhöhter Atemtätigkeit und
Entleerung von Blase und Darm äußert, aggressiv geboren. Der
Säugling erlebt die Mutter als „gute Brust“, wenn sie
all seine Begierden stillt, als „böse Brust“, wenn sie
sich verweigert. Auf erstere reagiert er spontan mit Liebe und Dankbarkeit,
auf die zweite ebenso spontan mit maßloser Wut. Nur langsam wird
er fähig, Liebe und Hass zu vermischen; also eine sogenannte Ambivalenztoleranz
zu entwickeln. Er wird sich seiner wütenden Attacken bewusst, gerät
in eine depressive Position und erwirbt die Fähigkeit zur Wiedergutmachung.
Das Bedürfnis des Kindes, auf eigenen Füßen zu gehen und
die Welt zu entdecken, bewirkt nach Meinung Gottschalchs eine Verstärkung
der Ambivalenz gegenüber der Mutter. Dieses Streben nach Autonomie,
das sich bis zur Adoleszenz fortsetzen wird, verbindet er mit Trennungsschuld
und Abhängigkeitsscham, in die das Kind folglich gerät. Um negative
Konsequenzen dieser Scham (Depersonalisation, Mangel an Verständlichkeit,
Schamlosigkeit oder narzisstische Wut) zu verhindern, ist ein „liebevoller
Kampf“, d.h. eine gegenseitige Befreiung voneinander nötig,
was schließlich aus der Abhängigkeit zum Anderen eine Verpflichtung
diesem gegenüber macht.
Im nächsten Kapitel, „Der Sohn-Vater-Konflikt“, schildert
Gottschalch, wie dem Sohn im Zuge des Ödipuskomplexes mit dem Vater
ein sexueller Rivale erwächst. Dieser versucht, Mutter und Kind aus
ihrer Zweisamkeit herauszulocken; das Mutter-Kind-Paar zur Vater-Mutter-Kind-Gruppe,
d.h. zur Familie zu erweitern. Gelingt ihm das, erfolgt beim bis jetzt
in der „Weibchenhaftigkeit“ versunkenen männlichen Kind
eine Trennung der männlichen und mütterlichen Identität.
Schafft er es nicht, ist der Vater schwach oder überhaupt nicht vorhanden,
läuft das Kind Gefahr in der Mutter-Sohn-Zweiheit zurückzufallen
oder zu verharren. In diese Zeit fällt auch die Zeit der Bildung
des „Überichs“, das Freud als Erbe des Ödipuskomplexes
betrachtete. Im idealtypischem Verlauf verinnerlicht der Knabe die Elternautorität
und wandelt dessen aggressive Komponenten, den Hass gegen die Eltern,
in Gewissensstrenge gegen sich selbst um.
Kapitel 6, „Geschwisterrivalität“, widmet sich den Reaktionen
des Jungen, wenn ein kleines Geschwisterchen in sein Leben tritt, was
natürlich mit Einschränkungen verbunden ist. Hier erweitert
sich der Ödipuskomplex zum Familienkomplex. Der Ältere hat den
Wunsch, den unliebsamen Konkurrenten zu beseitigen; kompensiert durch
den Bemächtigungswunsch, bei dem er sich teilweise mit dem Vater
identifiziert und das Geschwisterchen als Herrschaftsobjekt betrachtet.
Gottschalch nennt drei Aufgaben, die für eine positive Bewältigung
des Bruder-Schwester-Konflikts wichtig sind: Erstens, die Umkehr von Neid,
Eifersucht und Gier in Brüderlichkeit; zweitens, die Linderung der
narzisstischen Verletzung des Bruders, nicht gebären zu können;
drittens, die Überwindung der Inzestneigung durch Hinwendung zu anderen
Mädchen und Frauen.
Im 7. Kapitel unternimmt der Autor einen „Exkurs über die Familie“.
Diese Institution ermöglicht es dem Säugling, „menschlich
zu werden“, einerseits durch ein gewisses Vertrauen, damit es das
Leben nicht fürchtet, andererseits durch die Zuweisung eines sozialen
Ortes, einer sozialen Gruppe. Gleichzeitig beginnt neben dieser „Sozialisation“
die „Enkulturation“, in deren Verlauf sich der Mensch unbewusst
kulturelle Fähigkeiten und Inhalte seiner Kultur durch Nachahmung
und Verinnerlichung aneignet. Die Familie, der Ort dieses Aufbaus der
sozial-kulturellen Persönlichkeit, sieht sich der Meinung Gottschalchs
nach in den heutigen Industriegesellschaften großen gesellschaftlichen
Veränderungen gegenüber: Das allmähliche Schwinden kirchlicher
Wertvorstellungen, beschleunigte soziale Mobilität, ein längeres
Eheleben auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung, Probleme mit der Erziehung
der Jugendlichen, da diese bei längerer Ausbildung länger von
den Eltern abhängig bleiben sowie das Wachstum der Frauenbewegung
durch die Einbeziehung in den Arbeitsmarkt. Der Kapitalismus fördert
die Ausbreitung der Kernfamilie – d.h. die Gemeinschaft von Mann,
Frau und unverheirateten, unmündigen Kindern – im Gegensatz
zur größeren, weniger mobilen Verwandschaftsfamilie. Dies erklärt
sich der Autor durch die Tatsache, dass die Kernfamilie die „billigste
Agentur der Gesellschaft“ für den Aufbau der sozial-kulturellen
Persönlichkeit sei, was im Kapitalismus entscheidend sei.
In Kapitel 8, „Zwischen Zuckertüte und Schülerterror“,
geht Gottschalch auf die Schulzeit ein. Sie dauert heute länger als
früher und umfasst die Latenzphase, die Pubertät und einen Teil
der späten Adoleszenz. In diesem Zeitraum wird die kindliche Sexualität
eingeschränkt, der Sexualtrieb wird durch Schwellen wie Ekel, Scham
sowie ästhetische und soziale Anforderungen kultiviert. Der soziale
Ort der Latenzphase, also zwischen dem dritten, vierten Lebensjahr und
der Pubertät, ist die Schule. Sie ist in Gottschalchs Sicht für
die Kinder nicht nur der Ort von Lehren und Lernen, sondern auch „ein
emotionales Schlachtfeld“ – so ist denn die Familie für
viele ein Rückhalt bei den meist unvermeidlichen Schülerkrisen.
Besonders zwei Probleme hebt der Autor hervor: Erstens, in Kindergruppen
– speziell bei Jungen – werden wenig individuelle Freiheiten
gewährt; viele verstecken ihre Weichheit vor den anderen, geben sich
ebenso robust und werden dabei nur allzu oft in eine pseudomännliche
Haltung getrieben. Zweitens, die labile Sexualkultur mit ihrer unzureichenden
Aufklärung, die immer noch nur die biologische Vorgänge und
Sexualtechniken erklärt und die emotionalen Aspekte vernachlässigt,
wird kritisiert, da unzählige Heranwachsende mit ihren ersten sexuellen
Erfahrungen oft hilflos konfrontiert werden. Angesprochen wird auch die
„antisoziale Tendenz“, die sich bei Kindern in dieser Zeit
entwickeln und durch Stehlen, Zerstören oder Provokation manifestieren
kann; häufig auf Grund eines emotionalen Verlustes. Gottschalch vermutet
darin einen unbewussten Hilferuf an die Umwelt, sich um den Betreffenden
zu kümmern.
Kapitel 9, „Das Ringen um die Geschlechtsidentität“ beschreibt
die Konflikte des Jungen, wenn er sich von der anfänglichen, durch
die Identifizierung mit der Mutter bedingten „sexuellen Dualität“,
bei der er sowohl alle männlichen und weiblichen Eigenschaften für
sich fordert, löst. Er verspürt Eifersucht und Neid gegenüber
der Weiblichkeit, aber auch Angst vor ihr, was zu Selbsthass und Frauenhass
führen kann. Gottschalch bezieht sich auf Helene Deutsch, für
die Frauen die Repräsentantinnen des sozialen Patriarchats sind (weil
sie ihre männlichen Wünsche oft auf ihre Söhne projizieren
und dadurch unbewusst das Patriarchat verlängern), Männer die
des psychischen Matriarchats (weil sie häufig in Gruppen geraten,
der sie sich wie einer Übermutter unterordnen).
Im folgenden Kapitel, „Schöpferische Zerstörung“
ist der Kapitalismus das Thema. Diesen begreift Gottschalch als einen
Prozess der schöpferischen Zerstörung, der unaufhörlich
alte Strukturen zerstört und durch die „Durchsetzung neuer
Kombinationen von Dingen und Kräften“ neue schafft. Für
die einen bedeutet das Aufstieg, für die anderen Ausgrenzung und
Abstieg (durch den Verlust des Jobs); was auch zum „sozialen Sterben“
führen kann. Diesen Begriff übernimmt der Autor von Mario Erdheim
und Maja Nadig, die damit jenen Prozess bezeichnen, in welchem die sozialen
und kulturspezifischen Rollen zerfallen, unbewusste Werte und Identitätsstützen
ins Wanken geraten. Trotz einer daraus resultierenden Krise kann „soziales
Sterben“ auch neue Perspektiven eröffnen und produktive Kräfte
freisetzen.
Das elfte Kapitel behandelt das „Primat der Bürokratie“.
Gottschalch meint, dass ohne ein Minimum an „brauchbarer Illegalität“
in der Bürokratie soziale Systeme nicht funktionsfähig sind;
als Beispiel hierfür nennt er soziale Berufe, in denen Beamte zwischen
der Identifizierung zwischen ihrer Institution und den Klienten stehen.
Weiters weist er auf die Gefahr narzisstischer Persönlichkeiten in
Führungspositionen hin, denen es nur um primitive Macht über
andere geht. Mit dem Hinweis auf das Extrem von Schreibtischtätern
und verwaltetem Massenmord im Dritten Reiches warnt er vor einem Verlust
der individuellen Identität und einem kollektiven Narzissmus, der
eine irrationale Reaktion auf soziale Nöte darstellt.
Das letzte Kapitel des zweiten Abschnitts, „Es kommt kein Morgen
mehr“, widmet sich Gottschalch den letzten Jahren des Menschen.
Auf Grund der Vergreisung der Gesellschaft hat das Alter heute keinen
Seltenheitswert mehr und erfährt keine höhere Wertschätzung
mehr im Gegensatz zu früher. Manche blicken auf ein unerfülltes
Leben zurück, haben nie richtig gelebt und fürchten den Tod
am meisten. In der Infantilisierung der Alten erkennt der Autor eine große
Gefahr, die dem Betreffenden auch die letzte Würde nimmt. Als Konsequenz
davon verfallen manche in Apathie, andere in narzisstische Wut. Letztere
zielt dann entweder auf die Vernichtung des Beleidigers (Mord) oder auf
die Selbstvernichtung des Beleidigten (Selbstmord).
Im einzigen Kapitel des dritten Abschnitts, „Skeptische Gelassenheit“,
blickt der Autor zurück auf seine Erfahrungen mit Männlichkeit
und Gewalt. Er lässt ein offenes Ende, da seine Erkundungen diesbezüglich
noch nicht abgeschlossen sind.
Der Autor bemüht sich merklich, möglichst viele Aspekte zur
Erhellung seiner Annahmen zusammenzutragen. Bevor seine eigentlichen Ausführung
über die Thematik beginnen, schafft er mit der Betrachtung der zwei
Begriffe „Gewalt“ und „Männlichkeit“ eine
Basis, von der er ausgehen und immer wieder zurückkehren kann. Der
von ihm verwendete „doppelte Diskurs“ wird konsequent verfolgt,
die eingangs erwähnten zwei Kernhypothesen werden in jedem Kapitel
aus einem anderen Blickwinkel gesehen und nachvollziehbar belegt. Obwohl
es anfänglich den Anschein hat, dass die Kapitel 10 und 11 über
Kapitalismus und Bürokratie aus dem Rahmen fallen, ergänzen
sie das Gesamtbild letztlich doch sinnvoll, da sie sich (neben der physischen
und psychischen) eben auch der strukturellen Gewalt widmen. Gottschalch
bedient sich zahlreicher historischer, soziologischer, psychoanalytischer
und literarischer Quellen, um die vielen Facetten der Gewalt in unserer
Gesellschaft aufzuzeigen, wobei er sich aber manchmal spürbar aus
dem Kontext fallen lässt und abschweift. Nichtsdestotrotz ist das
Buch meiner Ansicht durchaus zu empfehlen, da es verständlich und
interessant geschrieben ist; Gewaltvoyeure, die auf Grund des Titels hoffen,
publizistisch bedient zu werden, sollten von dieser Lektüre allerdings
die Finger lassen.
Literatur:
Gottschalch, Wilfried: Männlichkeit und Gewalt.Eine
psychoanalytisch und historisch soziologische Reise in die Abgründe
der Männlichkeit; Juventa Verlag, Weinheim und München 1997
|