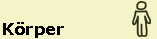
 |
WEBPORTAL:
MÄNNLICHKEITEN
|
||
| Start/Biographien N-S/Siemens | |||
|
|
Zitieren sie diesen Text bitte folgendermaßen: Rathberger, Andreas: Analyse einer Autobiographie von Werner von Siemens: Lebenserinnerungen. In: Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts für Geschichte der Universität Wien, http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/biographien/siemens_01.htm Lebenserinnerungen des Werner von Siemens
Überblick Leben und Karriere
Während seine Brüder Zweigstellen des Unternehmens in England und Russland begründeten, wuchs auch die ursprüngliche Fabrik in Berlin. Die Verlegung von Telegraphenlinien durch ganz Russland, von Unterwasserkabeln im Mittelmeer, Roten Meer und Atlantik, bis hin zum Bau einer durchgehenden Telegraphenverbindung von London bis Kalkutta machten „Siemens & Halske“ während der nächsten Jahrzehnte zu einem riesigen Unternehmen mit weltweiter Bedeutung. Gleichzeitig erwarb sich Siemens wissenschaftlichen Ruhm, verkehrte mit Forschern wie Magnus, du Bois-Raymond und Edison, wurde für seine von „Siemens & Halske“ realisierten Innovationen auf der Pariser Weltausstellung gefeiert und entdeckte 1867 das Dynamo-Elektrische Prinzip.
Als er 1898 mit der Niederschrift seiner Autobiographie begann, die er etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod vollendete, war er einer der angesehensten Unternehmer und Wissenschaftler seiner Zeit. Er erlebte die bedeutendsten Ereignisse des 19. Jahrhunderts, bereiste viele Teile der Welt auf gelegentlich abenteuerliche Weise, wurde vom Deutschen Kaiser mit dem Adelsprädikat „von“ geehrt und wurde Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Was lässt sich aus dieser, in der Retrospektive das ganze Leben betrachtenden Autobiographie über die Vorstellungswelt von Siemens, über sein „Männlichkeitsideal“ ableiten?
Beziehung zu den Eltern und Frage der „Vorprägung“
Obwohl Siemens offensichtlich für beide Eltern starke Gefühle hegt, beschreibt er ihren Tod und seine Gefühle dazu in relativ kurzen, dürren Worten. Während er zu Krankheit und Sterben seiner Mutter meint „Ich unterlasse es, den tiefgehenden Schmerz über den Verlust der Mutter zu schildern.“, fügt er in Bezug auf seinen Vater überhaupt bloß lapidar hinzu „Kaum ein halbes Jahr darauf, am 16. Januar 1840, verloren wir auch den Vater.“(6). Seine Erläuterungen zu den Tugenden und Eigenschaften der Eltern erscheinen eher als Wiedergabe idealisierter Rollenbilder denn als tatsächliche Beschreibung lebender Menschen, was zu dem Schluss verleitet, eine persönlichere Beschreibung seiner Gefühle für die Eltern wäre ihm vielleicht unangenehm gewesen oder unangebracht erschienen.
Siemens erkennt das Vorbild der Ahnen und des Vaters, die
Taten seiner Brüder, sowie sein Zusammentreffen mit reichen Gönnern
und herausragenden Personen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik
durchaus als wichtige Einflüsse auf sein Leben an. Auch glaubt er
an angeborene Talente und den „schicksalhaften Zufall“, der
ihn in die unter anderem in die Ereignisse von 1848 verwickelt (7).
Nichtsdestotrotz betrachtet er sein Leben keinesfalls als vorherbestimmt.
Vielmehr geht aus seinen Aufzeichnungen hervor, dass er in erster Linie
seine eigenen Taten, seinen Fleiß, seinen Wissensdrang, sein Verantwortungsbewusstsein,
sein gewissenhaftes Arbeiten und seine gleichzeitige Beschreitung des
„rein wissenschaftlichen“ wie des unternehmerischen Weges
als entscheidend für seinen Erfolg betrachtet (8).
„Soldatische“ Tugenden: Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein, Ehre, Tapferkeit, Abenteuerlust, „Tatkraft“, Patriotismus
Siemens hätte seinen Aussagen zur Folge die 1862 ohne seinen Antrag erfolgte Wahl ins Preußische Abgeordnetenhaus nur aus Pflichtbewusstsein angenommen (19). Während dieses bis 1866 dauernden Intermezzos als Träger eines politischen Amtes geriet er anlässlich einer Abstimmung über die Erhöhung der preußischen Militärausgaben, im Vorfeld des Krieges mit Österreich, in einen Gewissenskonflikt zwischen der Loyalität zu seiner „Deutschen Fortschrittspartei“ bzw. zum König. Er ist daher froh nach dem Krieg seine „politische Pflicht“ als erfüllt betrachten zu können und scheidet aus dem Abgeordnetenhaus aus (20).
Auch andere „soldatische“ Moralbegriffe wie
„Ehre“ und „Tapferkeit“ wurden Siemens schon als
Kind beigebracht. Dies äußert sich in Soldatenleben imitierenden
Spielen, wie dem täglichen „Kampfspiel“, bei dem Stadtschüler
den Schulweg versperrten. Laut Siemens trugen diese Spiele dazu bei seine
„Tatkraft zu stählen“. Als seinem Bruder als Konsequenz
eines gemeinsam beschlossenen „Duells“ mit Pfeil und Bogen
vom Vater eine Züchtigung mit dem Rohrstock droht, enthüllt
Siemens seine Beteiligung und den Hintergrund des Vorfalls, worauf die
Strafe unterbleibt, da ein „Duell“ vom Vater als ehrenhafte
Verhaltensweise angesehen wird.(21)
Auch für seine spätere Jugendzeit gesteht Siemens eine gewisse
Leidenschaft für Duelle ein, die ihm als Soldat 1842 ein Monat Festungshaft
in Spandau einbringt (22). Exerzieren,
Disziplin, und Kameradschaft, sowie überhaupt alle Aspekte des Soldatenlebens
werden von Siemens jedoch als positive Einflüsse gelobt, einschließlich
jener „grober und scheinbar harter Behandlung“, die er als
etwas „Auffrischendes und Anregendes“ bezeichnet (23).
Die in seiner Autobiographie oft erwähnte „Vaterlandsliebe“, der Wunsch nach einem „einigen deutschen Reich“, wie er ihn 1864 gegenüber dem Generaldirektor der französischen Telegraphen äußert, verbunden mit der Überzeugung, die Deutschen seien bisher ungerechterweise nur „passives Material für die Weltgeschichte“ gewesen (24), entsteht in Siemens wohl schon durch den Einfluss seines Vaters. Später wird die „Vaterlandsliebe“ durch sein Leben im preußischen Militär und schließlich durch das Erleben der Entstehung des Deutschen Kaiserreiches bestätigt. Bei Siemens ist damit die mehrfach betonte persönliche Loyalität zur Dynastie der Hohenzollern verbunden. Diese hat ihre Ursprünge in der bereits erwähnten Überzeugung, dass allein der von König Friedrich Wilhelm III. gestattete Eintritt ins preußische Militär Siemens Ausbildung und Karriere ermöglicht hätte. Ein anderer Grund für die Loyalität ist die Intervention des späteren Königs Wilhelm I. gegen die 1855 geplante „Internierung“ Siemens’ in Russland, bis zur Fertigstellung der damals im Bau befindlichen Telegrafenlinie (25).
Die von Siemens so gerühmte „Tatkraft“ geht mit einer gewissen Abenteuerlust einher. Er meint selbst, es gehöre bei ihm „immer eine gewisse Erregung dazu, um mir die volle Herrschaft über meine geistigen Fähigkeiten zu geben.“ (26). Der erste große „Beweis“ dieser „Tatkraft“ sowie der übrigen Merkmale eines stark militarisierten Männlichkeitsideals ist ohne Zweifel die von Siemens im Stil eines „großartigen Abenteuers“ beschriebene Teilnahme an den Kämpfen in Dänemark. Die Erstürmung und Verteidigung der Festung Friedrichsort und die Sicherung des Hafens von Kiel werden als wunderbare Gelegenheit geschildert, endlich für die „nationale Frage“ zu kämpfen, Abenteuer zu erleben, ein eigenes Kommando auszuüben und den eigenen Einfallsreichtum sowie die praktische Anwendbarkeit und Wichtigkeit des wissenschaftlich-technischen Talents in Form von Seeminen zu beweisen (27). Das Abenteuer scheint dabei bei Siemens über der Disziplin zu stehen, was durch seine damalige Jugend gerechtfertigt wird. Er selbst meint, die Erteilung offizieller Befehle und das Ende des abenteuerlichen Charakters seines Kommandos habe diesem schließlich jeden Reiz genommen.
Aber auch nach dem Ende seiner Militärzeit scheint sich Siemens ab und zu nach der genannten „gewissen Erregung“ zu sehnen. Bei der unterhaltsamen Beschreibung abenteuerlicher Verlegungen von Tiefseekabeln bei stürmischer See und seinen geradezu im Stil von Karl May geschilderten Reisen in Russland, Ägypten und am Kaukasus hat Siemens mehrfach Gelegenheit, dem Leser seine Tapferkeit, „Tatkraft“ und seinen Einfallsreichtum zu beweisen. So lenkt er trotz hartgefrorener Hände seinen Schlitten durch das winterliche Russland (28), vertreibt auf der Cheopspyramide durch das geschickte Anwenden elektrostatischer Phänomene abergläubische, seine Reisegruppe attackierende Araber (29), rettet beim Untergang des Passagierschiffes Alma im Roten Meer durch entschlossenes Zupacken ängstliche junge Damen vor dem Ertrinken (30), schlägt nach dem Schiffbruch auf einer einsamen, dem Sudan vorgelagerten Insel gemeinsam mit anderen Europäern eine Meuterei der aus Eingeborenen bestehenden Schiffsbesatzung nieder (31), verhindert durch geistesgegenwärtiges Eingreifen den Untergang eines Kabelverlegeschiffes im Mittelmeer (32) und durchquert zerklüftete, von Räubern durchstreifte Schluchten im Kaukasus (33).
Zusammenfassend macht das im 19. Jahrhundert übliche, stark militarisierte, die schnellen Entschlüsse, „Tatkraft“ und Mut, Ehre und Pflichtbewusstsein betonende Männlichkeitsideal, kombiniert mit Patriotismus und dem Gefühl der Überlegenheit der „Europäischen Zivilisation“ einen wesentlichen Bestandteil von Siemens Gedankenwelt, seines Selbstideales aus. Wissenschaft, Technik und Forschung werden durch ihre Bedeutung für den Sieg der eigenen Nation „im großen Wettkampfe der zivilisierten Welt“, wie Siemens meint, ebenfalls in Zusammenhang mit den „soldatischen“ und patriotischen Tugenden gebracht.(34)
Siemens und die Frauen
Auf Kontakte zu Frauen geht Siemens in seiner ganzen Autobiographie
nur sehr oberflächlich ein. Schon seine Mutter beschreibt er nur
als Verkörperung des Rollenbildes der liebvollen, gutmütigen,
stets von Sorge erfüllten Mutter, nicht jedoch als eine eigenständige
Person mit individuellen Zügen oder gar Meinung zu bestimmten Themen
(35). Übrige weibliche Verwandte
werden meist bloß namentlich erwähnt. Das Schicksal seiner
Schwestern lediglich in Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Verheiratung
etwas ausführlicher behandelt. Außereheliche Affären oder sexuelle Beziehungen
gleich welcher Art hat Siemens entweder nicht, oder, was wahrscheinlicher
ist, betrachtet sie als Tabuthema und verschweigt sie. Ebenso ohne genauere
Angaben über die der Hochzeit vorangehende Beziehung kommt seine
Ehe mit Mathilde Drumann zustande: Nach einer längeren Beschreibung
des tragischen Schicksals der Tochter seiner an einem Lungenleiden verstorbenen
Kusine, die er als selbstlose, sich aufopfernde Fürsorgerin und Pflegerin
ihrer todkranken Mutter lobt, meint er, für den nichtsahnenden Leser
überraschend, er habe 1852 nun endlich die nötigen Mittel gehabt,
sich den „lange gehegten Wunsch“ zu erfüllen, um ihre
Hand anzuhalten. Zum Zeitpunkt dieses Beschlusses hat Siemens seinen eigenen
Angaben zufolge Mathilde seit acht Jahren nicht gesehen und steht nicht
einmal mehr in Briefkontakt zu ihr (36)!
Damit nicht genug, bricht er unmittelbar nach dem „im Vorbeigehen“
erledigten Antrag ohne sie nach Russland auf. Erst im Oktober desselben
Jahres findet die Hochzeit statt. Zwar beschreibt Siemens in zärtlichen
Worten die Flitterwochen in Paris, überspringt jedoch dann kurzerhand
die 13 Ehejahre bis zu ihrem Tod und zieht Bilanz über die von Mathilde
geborenen Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter (37). Zur Hochzeit mit seiner zweiten Frau Antonie kommt er überhaupt
ohne jegliche Vorankündigung oder Details darüber, wie er sie
kennenlernte. Er erwähnt lediglich ihren Namen und das Hochzeitsdatum,
führt aus, dass sie eine entfernte Verwandte aus der Gegend von Stuttgart
sei und kombiniert diese Feststellung mit einer Anspielung auf die sich
damals im Gange befindlichen Vereinigung Nord- und Süddeutschlands
(38). Etwas offener zeigt sich Siemens im Zusammenhang mit der Beschreibung seiner Reiseabenteuer. Hier erwähnt er Frauen entweder als Objekt der Bewunderung oder als hilflose Wesen, die es zu erretten beziehungsweise beschützen gilt. Im Zusammenhang mit einer Kabellegung vor der spanischen Küste beschreibt Siemens ein ihm und seinen Begleitern in der Stadt Almeria auf einem Fest auffallendes junges Mädchen „das durch einstimmiges Votum unserer aus allen westeuropäischen Nationen zusammengesetzten Schiffsgesellschaft für das Ideal weiblicher Schönheit erklärt wurde“ (39). Später kann er bei der Beschreibung der bereits erwähnten Rettung der weiblichen Passagiere beim Untergang der Alma nicht umhin, geradezu triumphierend zu erwähnen, dass er in „der sich ängstlich an mich schmiegenden, von Wasser triefenden Dame“ tatsächlich die „stolze, junge Kreolin, die wir noch vor wenigen Stunden in dem Verehrerkreise, den ihre Schönheit um sie gebildet hatte, aus bescheidener Ferne bewundert hatten“ erkannt hätte (40).
Siemens und die
Gesellschaft Annerkennung schien ein wichtiges Ziel in Siemens Leben
gewesen zu sein. Er selbst meint in einer kurzen Selbstcharakterisierung,
er habe stets das Bedürfnis gehabt, „mehr zu sein als zu scheinen“,
räumt jedoch ein, dass man das auch nur als besondere Form der Eitelkeit
betrachten könne (41). Tatsächlich
freut er sich über das Ansehen, dass er als Offizier bereits in relativ
jungen Jahren in Preußen genießt (42).
Mit deutlichem Stolz schildert er, wie er nach der Verteidigung Kiels
vom Oberkommandierenden General Wrangel persönlich empfangen und
geehrt worden sei (43). Auch das ihm
als Unternehmer vom mächtigen russischen Minister Graf Kleinmichel
persönlich entgegengebrachte Vertrauen (44)
schildert er in einer Ausführlichkeit, die auf besonderen Stolz schließen
lässt. Eigenartigerweise verliert er jedoch kein Wort über die
ihm anlässlich seiner Ehrung durch die Pariser Akademie der Wissenschaften
von Alexander von Humboldt übersandte Glückwunschadresse oder
den anschließenden persönlichen Besuch des prominenten deutschen
Naturforschers (45). Als besondere Ehrung empfindet er das ihm vom späteren König Wilhelm von Preußen während seines Russlandaufenthaltes entgegengebrachte Wohlwollen (46). Wiederholt äußert er seine von diesem Vorfall hergeleitete Loyalität gegenüber den Hohenzollern und freut sich, als ihm Wilhelm, trotz seines gegen die Politik des Königs gerichteten Stimmverhaltens als Abgeordneter, 1867 den „Kronenorden“ verleiht (47). Interessant ist allerdings die von Siemens im Anschluss daran geschilderte Episode: Die vom Kaiser bestätigte Ernennung zum „Kommerzienrat“ lehnt Siemens ab, da sie seiner Meinung nach zu seinen übrigen Titeln nicht passen würde. Auch auf den alternativen Vorschlag, sich einen höheren Orden zu erbitten, geht er nicht ein, da man eine solche Auszeichnung „dankend annimmt, aber nicht darum bittet“. Siemens glaubt schon, beim Kaiser in Ungnade gefallen zu sein, als dieser auf einem Hofball wortlos an ihm vorbeigeht, wird jedoch dafür später geehrt, indem er der Gemahlin des Kaisers vorgestellt wird. Diese Episode macht deutlich, wie sehr Siemens auch als Unternehmer und Wissenschaftler in die Hofgesellschaft integriert ist, wie wichtig auch für ihn Orden und kaiserliche Ehrungen sind. Sein eigenartiges Verhalten und die von ihm ausgedrückte Genugtuung darüber, sich nicht wie andere „an die hohen Herrschaften heranzudrängen“, räumt jedoch die Möglichkeit ein, trotz seiner vielbeschworenen Treue zum Kaiser sei dies vielleicht mehr eine gesellschaftlich erwartete Selbstverständlichkeit als ein tatsächliches Bedürfnis gewesen.
Gerne baut Siemens frühe Begegnungen mit später
berühmten Personen in seine Autobiographie ein, so lernt er bei der
Verteidigung Kiels 1848 den späteren angesehen General von der Tann
kennen (48). Er selbst gibt dem damaligen
Brieftaubenbesitzer Reuter, der durch die Telegraphenlinien arbeitslos
wird, den Rat, in London ein „Depeschen-Vermittlungsbureau“
zu eröffnen, was diesen weltberühmt, reich und zum Baron macht
(49). Wohl gerade angesichts seines
mehrfach geäußerten, mit der mittelmäßigen Schulbildung
begründeten Minderwertigkeitsgefühls, dass er gegenüber
den „reinen“ Wissenschaftern empfindet, freut es ihn, mit
wichtigen Gelehrten seiner Zeit, wie Faraday, du Bois-Raymond, Magnus
oder Thomas Edison zu verkehren und von ihnen anerkannt zu werden. Stolz
schildert er die Ehrung seiner Arbeiten durch die Pariser Akademie der
Wissenschaften (50) auf der Londoner
Weltausstellung 1851 und die Ernennung zum ordentlichen Mitglied der preußischen
Akademie der Wissenschaften (51).
Mehrmals beschwert sich Siemens, er hätte erleben müssen, wie seine Erfindungen und Entdeckungen wegen des mangelhaft entwickelten Patentwesens anderen zugeschrieben worden seien. Er betrachtet das zur Kenntnis nehmen von den eigenen vorangegangenen, fremden wissenschaftlichen Verdiensten auch auf internationaler Ebene als „Ehrenpflicht“ (52). Er setzt sich daher wiederholt für ein einheitliches, dauerhaft und allgemein gültiges Patentrecht ein (53)und akzeptiert in wissenschaftlichen Streitfällen auch gegen ihn ausgehende Schiedssprüche auf vernünftiger Grundlage, obwohl er beispielsweise für die Erfindung der Schießbaumwolle (54)offensichtlich gerne den Ruhm geerntet hätte. Als man sich 1884 auf einer Konferenz international auf die Einheit „Ohm“ als Maß für den elektrischen Widerstand einigt, stimmt auch Siemens zu, obwohl dies das Ende der bereits weit verbreiteten alternativen Maßeinheit „Siemens“ bedeutet (55). Neben der wissenschaftlichen Anerkennung scheint für Siemens auch die wissenschaftliche Fairness, also der von ihm schon an seinem Vater bewunderte Gerechtigkeitssinn, ein wichtiges Ideal zu sein.
Zusammenfassung
Obwohl Siemens sein Leben nicht von unbeeinflussbaren
Faktoren vorherbestimmt sieht, und seine individuellen Entscheidungen
und Taten als entscheidenden Faktor betrachtet, fühlt er sich stets
als Bestandteil eines größeren Ganzen. Seine Tätigkeit
soll nie ihm allein dienen, sondern dem Wohl der Familie, das durch den
Aufbau eines Familienunternehmens auf Generationen gesichert werden soll
und dem Aufstieg des „Vaterlandes“ zur dominierenden Macht
Europas, dem Fortschritt der „überlegenen Europäischen
Zivilisation“. Seine Schilderungen zu den Jahren 1848, 1859 und
1866 machen besonders deutlich, wie sehr er sich in den „Gang der
Weltgeschichte“ und in das „Schicksal“, das er allerdings
von den Taten und Entscheidungen der Menschen abhängig sieht, eingebettet
fühlt. Siemens ist überzeugt, den Beginn eines „Naturwissenschaftlichen
Zeitalters“ (56) zu erleben,
an dessen Heraufdämmern mitgewirkt zu haben, macht ihn glücklich.
Allzu persönliche oder private Details, wie auch seine Beziehung
zu Frauen, erscheinen ihm daneben wohl trivial und nicht wert, in seiner
Autobiographie erwähnt zu werden.
Literatur & Anmerkungen:
(1) Siemens, Werner von: Lebenserinnerungen, 18. Aufl., München 1986 (1. Auflage 1892), S 15. (35) vgl. oben Abschnitt "Beziehung zu Eltern und Fragen der Vorprägung" (46) vgl. Abschnitt "Soldatische Tugenden"
|
||