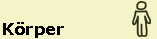|
| |
|
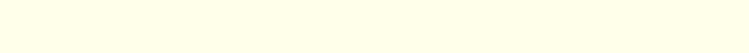
Zitieren sie diesen Text bitte folgendermaßen:
Benesch, Peter:
Männlichkeitsverständndis von Michel de Montaigne.
Analyse des autobiographischen Textes: Tagebuch einer Badereise. In:
Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts
für Geschichte der Universität Wien,
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/biographien/montaigne_01.htm
Männlichkeitsverständnis
von Michel de Montaigne
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, der Frage nach
dem Männlichkeitsverständnis von Michel de Montaigne nachzugehen,
wobei als Grundlage seine im "Tagebuch einer Badereise" festgehaltenen
Reiseschilderungen dienten. Es sollte also untersucht werden, inwieweit
er in seinem Reisetagebuch Aspekte von Männlichkeit andeutet oder
ausführt. Dabei wurde sein Handeln, Denken und seine Emotionen aus
der Genderperspektive betrachtet, um Einblicke in männerspezifische
Grundmuster zu erhalten. Interessante Details über Anschauungen Montaignes
wurden meist im Zusammenhang mit seinen in drei Teilen erschienenen Essais
in der Forschung erläutert. Hier wurden generelle Meinungen deutlich,
die sich in gewissen Lebensphasen manifestiert haben und so in die Gedankenwelt
des Philosophen zu eben dieser Zeit Einblick gewährten. Daher war
es nicht immer notwendig, exakten Literaturhinweisen zu der Badereise,
die sehr spärlich gesät sind, nachzugehen, weil in den vielen
Biografien das Gedankengut Montaignes teilweise gut veranschaulicht wurde.
So wurde auch das Problem mit der kargen Berichterstattung in der Quelle
gelöst, wo in erster Linie Land- und Ortschaften, seine gesundheitlichen
Probleme, u.s.w., nicht aber seine persönliche Meinung über
Gott und die Welt geäußert wurde.
MONTAIGNE
Michel de Montaigne wurde am 28.Februar 1533 auf dem Schloss
Montaigne geboren, das etwa 60 km landeinwärts von Bordeaux liegt.[1]
Dort waren seine Vorfahren Großkaufleute, die noch den bürgerlichen
Namen Eyquem trugen; sie sind einige Zeit vorher mit dem Kauf des Schlosses
Montaigne, das zu den Lehen des Erzbischofs von Bordeaux gehört,
geadelt worden. Michel ist der erste seiner Familie, der sich nach dem
neu erworbenen Adelssitz „Seigneur de Montaigne“ nennt.
Sein Vater, begeisterter Humanist und Anhänger der
Renaissance, will, dass sein Sohn Latein gleichsam als Muttersprache lerne,
weswegen er für den zweijährigen Michel einen deutschen Hauslehrer
bestellt, der mit seinem Zögling nur lateinisch reden soll. Der junge
Montaigne spricht mit vier Jahren bereits Latein und kann später
die lateinischen Klassiker mühelos lesen und zitieren. Seine humanistische
Ausbildung erhält er mit sechs Jahren auf dem Collége de Guyenne,
eine der berühmten Adelsakademien des Landes. Anschließend
absolviert er das Rechtsstudium an der Universität in Bordeaux, das
er an der Universität Toulouse fortsetzt. Schließlich wird
er mit 21 Jahren Rat an einem Landgericht, mit 24 Jahren Parlamentsrat
und Richter in Bordeaux, eine Magistratenstelle, welche er 13 Jahre lang,
von 1557 bis 1570, innehat.
Mit 32 Jahren heiratet er eine Adelige aus Bordeaux, die
ihm sechs Töchter geboren hat, von denen eine einzige am Leben blieb.
Es war zu seinem Missfallen kein Sohn dabei, dem er sein Schloss Montaigne
übergeben hätte können. Er selbst hat das Schloss 1568
nach dem Tod seines Vaters übernommen und sich fortan Messire Michel,
Seigneur de Montaigne genannt. Wenige Jahre später gibt er sein Amt
als Parlamentsrat in Bordeaux auf und zieht sich 1571 definitiv auf sein
Schloss Montaigne zurück.
Wenige Jahre später melden sich die ersten Anzeichen
einer Nierensteinkrankheit, an der er wie sein Vater im Jahre 1592 –
er ist noch nicht einmal sechzig Jahre alt - stirbt und in der Feuillantiner-Kirche
von Bordeaux beigesetzt wird. Aufgrund seines Misstrauens gegenüber
Ärzten unternimmt er die Bäderreise: „Ich hatte es den
22.Juni 1580 verlassen, um nach La Fére zu gehen. Demnach hatte
meine Reise siebzehn Monate und acht Tage gedauert“[2], die er uns
in seinem Tagebuch schildert.
DAS REISETAGEBUCH
– DIE QUELLE
Montaigne war ein Liebhaber des Reisens, der es genoss,
sich in der Welt umzusehen.[3] Die größte seiner Reisen erfolgte
in den Jahren 1580/81, wo er über Süddeutschland nach Italien
aufbrach, um in den Bädern Heilung von seinen Nierensteinen zu finden.
Darüber wurde Tagebuch geführt, das rund 200 Jahre später
(1774) unter dem Titel Journal de voyage de Michel de Montaigne erstmalig
veröffentlicht wurde.
Es handelt sich mehr als um eine Bäderreise, in der
er neben der Wirkung der Bäder auf die Nierenfunktion alles notiert,
was ihm an Menschen, Sitten und Kulturwerken auffällt. Montaigne
passt sich den lokalen Gepflogenheiten des jeweiligen Landes an, lernt
Italienisch und schreibt sogar einen Teil des Tagebuchs in dieser Sprache.
Der erste Teil des Tagebuchs ist nicht selbst von Montaigne
verfasst, sondern seinem Sekretär diktiert worden, wobei jedoch der
gesamte Text äußerst trocken geschrieben ist. Sachliche Beobachtung
und keine Interpretation, denn die Welt besteht aus lauter Fakten, an
der wir nicht rühren dürfen. Er meint in seinen Essais, dass
die Beurteilung offen bleiben muss, „weil auch sie jeweils nur abhinge
vom Zufall der eigenen Denkweise, deren Beschränkung eben mittels
des Reisens durchbrochen werden soll.“[4]
Das Reisetagebuch stellt eine Art Notizheft dar, in der
alles Gesehene einfach in der Reihenfolge seines Auftretens festgehalten
wird.
Auffällig sind seine realienkundlichen Details. Es
werden die kulinarischen Sitten der verschiedenen Städte vermerkt,
die Beschaffenheit der Betten, des Essgeschirrs, der Küchen und Öfen
in den Gasthäusern. Bei Wiedemann[5]
heißt es sogar: „Sein Buch, von dem wir gehofft hatten, es
werde ein Schreiten durch die höchsten Regionen des Geistes sein,
erinnert eher an einen Hotel- und Gaststättenführer. Der Autor
scheint die Kathedralen oft zu vergessen, beugt sich aber mit nie nachlassender
Neugier über den Teller“. Die besuchten Städte werden
in ihrer geografischen Lage, ihrer Bewässerung, ihrem Grundriss und
ihrem Wappen beschrieben.
Unbekannt ist, wo die Reisegesellschaft zusammengestellt
worden ist, da die ersten Seiten des Tagebuchs fehlen; jedenfalls bestand
die Reisegesellschaft aus fünf berittenen Edelleuten inklusive einer
unbestimmten Zahl von Dienern.[6] Montaigne, der vordergründig wegen
seines Steinleidens diese Reise unternahm, war damals 47 Jahre alt, seine
Begleiter alle unter zwanzig.
Das Reisetagebuch von Montaigne ist nach den besuchten Städten gegliedert
und erstreckt und sich vom französischen Startort Beaumont über
deutsch Gebiete wie Augsburg schließlich nach Rom, das mit einigen
Zwischenstationen mehrmals besucht wird. Ein beträchtlicher Teil
des Manuskripts stammt von der Hand eines Dieners, der Montaigne als Sekretär
diente und der stets von „Der Herr von Montaigne“ spricht.
Es stellt sich allerdings die Frage, die auch in der Literatur nicht gänzlich
geklärt erscheint, ob die Berichte von Montaigne diktiert und eins
zu eins niedergeschrieben wurden, oder ob der Schreiber eigene Gedanken
hat einfließen lassen. So schreibt der Diener manchmal in Ich-Form,
was aber beiden Meinungen Nahrung liefert, denn einerseits könnten
es seine eigenen Eindrücke sein, andererseits könnten diese
Ich-Wendungen aber auch unter dem Einfluss eines Diktates entstanden sein.
Auch fehlen - wie bereits erwähnt - die ersten Seiten
des Reisetagebuchs, was möglicherweise diese Unklarheit beseitigen
könnte.
Anlass der Reise war vermutlich sein Gesundheitszustand:
er wurde von Koliken geplagt und versprach sich von den Bädern und
Heilwässern Linderung für seine Schmerzen.
Die Namen bekannter europäischer Bäder (außerhalb
Frankreichs) legten somit auch die grobe Reiseroute fest. Andere mögliche
Gründe der Reise wären die Flucht von den Religionskriegen oder
eine Pilgerfahrt nach Rom mit einigen Zwischenstationen.
Montaigne erforscht also mit großer Neugierde, was
ihm in den verschieden Städte kulinarisch geboten wird. Die Beschreibung
der Gasthäuser, Wirte und deren spezifische Essgewohnheiten und Speisefolgen
nehmen also sehr breiten Raum in den Reiseschilderungen ein. Drei Fragen
tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder auf: Wie betten sich die Leute,
wie heizen sie ihre Häuser und aus welchem Geschirr essen sie? Montaigne
wollte die fremden Sitten aber nicht nur beobachten, sondern auch verstehen.
Natürlich werden auch die Kirchen beschrieben, jedoch
relativ oberflächlich. Aber aufgrund der politischen Situation –
die Erinnerung an die Bartholomäusnacht noch frisch - beschäftigt
Montaigne freilich auch die religiöse Frage. Montaigne war Katholik
und hat die Bräuche der Kirche auch auf seiner Reise befolgt: er
wohnte regelmäßig der Messe bei, geht zur Beichte und verrichtet
Tischgebete und Vaterunser. Die Reformation lehnte er ab.
Neben dem Interesse für die Technik, das sich an neuartigen Geräten
und Konstruktionen erschöpfte, waren auch die Menschen von Belang.
Vor allem interessante Mensch – Gelehrte – erweckten das Interesse
des Franzosen.
Und, wie im Titel schon angekündigt, werden die Bäder
und vor allem die Beschaffenheit des Wassers genau unter die Lupe genommen,
zum Beispiel heißt es in Venedig: „Das Wasser lässt einen
rötlichen Satz zurück, auch auf der Zunge, wie es der Herr von
Montaigne selbst fand; auch fand er es ganz geschmacklos und glaubt, daß
es eher Eisen enthält.“[7]
ASPEKTE
VON MÄNNLICHKEIT
Allgemeines
Montaigne greift zu Beginn seiner Reiseschilderungen eine
Geschichte von Ambroise Paré, einem Chirurgen, auf, in der eine
Geschlechtsumwandlung stattfindet (die gleiche Geschichte erzählt
er übrigens auch in den Essais [I,20]):
„Die dritte Merkwürdigkeit betrifft einen Mann,
der noch am Leben ist und Germain heißt. Er ist von niedriger Herkunft
und ohne Geschäft noch Amt. Er war bis in das Alter von 22 Jahren
ein Weib und allen Bürgern der Stadt bekannt; auch ward bemerkt,
daß er ums Kinn ein wenig mehr Haar hatte als die andern Mädchen,
weshalb er die bärtige Marie genannt wurde. Eines Tages, als er sich
anstrengte einen Sprung zu machen, traten seine männlichen Geschlechtsteile
hervor, und der Kardinal Lenoncourt, damals Bischof von Châlons,
gab ihm den Namen Germain. Er hat sich gleichwohl nicht verheiratet, bekam
aber einen sehr starken Bart. Wir vermochten ihn nicht zu sehn, da er
auf dem Dorf war. Es ist auch in diesem Ort noch ein im Mund der Mädchen
ordinäres Lied gebräuchlich, worin sie sich gegenseitig auffordern,
die Beine nicht zu weit zu spreizen, es könnte ihnen sonst passieren,
daß sie zu Männern würden gleich Marie Germain. Man sagte
mir, daß Ambroise Paré diesen seltsamen Fall in sein Buch
über Chirurgie aufgenommen hat; in der Tat lautet die Erzählung
ganz bestimmt und wurde dem Herrn von Montaigne auch von den angesehensten
Beamten der Stadt bezeugt.“ [8]
Es berechtigt, sich als Mann bezeichnen zu lassen, indem
man die Rolle eines anderen Geschlechts spielt.[9] Montaigne schreibt
in einer langen Tradition, die bis in die Antike zurückreicht und
in der nie ein Mann zu einer Frau wurde, weil die Natur immer zum Vollkommensten
hin tendiert und nicht umgekehrt, in solch einer Weise verfährt,
dass, was vollkommen ist, unvollkommen werden könnte.
Darin liegen auch die männliche Angst einer Verweichlichung
sowie die Befürchtung, dass sich Frauen männliche Merkmale zulegen
könnten, begründet. Montaigne zitiert in seinen Essais Plinius,
dass er Frauen gesehen habe, die sich in ihrer Hochzeitsnacht zu Männern
verwandelt haben. Für Montaigne scheinen diese Geschichten nicht
ungewöhnlich, da für ihn klar zu sein scheint, dass Frauen gerne
einen Penis hätten.
Verstärkt wird die Vorstellung Montaignes in einer
Geschichte, die unmittelbar davor geschildert wird:
„Sieben oder acht Mädchen aus der Umgebung von
Chaumont-en-Bassigny verabredeten vor einigen Jahren, sich in Männer
zu verkleiden und so in die Welt zu gehen. Eine unter ihnen kam unter
dem Namen Mary nach diesem Vitry, bestritt ihr Leben als Weber und galt
als ordentlicher junger Mann, der sich jeden zum Freund machte. Er verlobte
sich in Vitry mit einer Frau, die noch am Leben ist; aber nach einem Zerwürfnis,
das eintrat, ging ihr Handel nicht weiter. Als er sich darauf nach dem
genannten Ort Montier-en-Der begab, wo er seinen Unterhalt immer mit demselben
Gewerbe gewann, faßte er Zuneigung zu einer anderen Frau und heiratete
sie auch. Er lebte vier oder fünf Monate mit ihr zu seiner Zufriedenheit,
wie man sagt, aber darauf wurde er von jemand aus Chaumont erkannt und
die Sache dem Gericht übergeben, das ihm zum Tod durch den Strick
verurteilte: das wollte sie noch lieber erleiden als wieder ein Mädchen
werden. Sie wurde auch richtig gehängt, wegen der unerlaubten Erfindung,
die Unvollkommenheit ihres Geschlechts zu ergänzen.“[10]
Montaigne ändert abrupt seine Verwendung des Personalpronomens
– „bestritt ihr Leben“, „Er verlobte“, „das
ihm zum Tod“, „das wollte sie“.[11] Die Götter
kamen dem jungen Weber nicht zu Hilfe, schenkten ihm keinen Penis, der
es ihr ermöglicht hätte, ihr Leben als Mann weiterzuleben. Es
fehlte ihm einfach das Geburtsmahl des von ihm angeeigneten Status, weshalb
er auch als Frau starb.
Ein Mann oder eine Frau zu sein, bedeutete damals einen
sozialen Rang in der Gesellschaft zu haben – das biologische Geschlecht
war im 16.Jahrhundert eine soziologische Kategorie.[12]
Ehre
Einer der zentralen Aspekte ist der Begriff der Ehre, der
insofern als männlich eingestuft werden kann, weil Ehre zu haben
damals als männliche Tugend angesehen wurde.
Jedes Glied der Gesellschaft partizipierte in gestufter,
nach unten abnehmender Form an dem in der Gesellschaft vorhandenen Vorrat
an Ehre und sozialem Prestige – der Adelige besaß mehr Ehre
als der Bürger, der Bürger mehr als der Bauer und der Herr mehr
als der Knecht. Um die Ehre nach außen zu demonstrieren, war Vermögen
nötig.[13]
Das machte sich natürlich auch in den Einladungen und
Festen bemerkbar, die der Adel dazu benutzte, seine soziale Stellung zu
veranschaulichen und zum Teil überdimensionale Feste über mehrere
Tage und Wochen zu veranstalten.
Die meisten Begegnungen stellen das Ritual in den Mittelpunkt.
Bei offiziellen Begrüßungen oder Einladungen wird Montaigne
(meist vom Bürgermeister oder dessen Stellvertreter) in manchen Städten
oft mit einer Geschenkübergabe (Wein) und einer Ansprache empfangen.[14]
Auf diese Ansprache muss er dann antworten, was ihm jedoch willkommen
ist, da für ihn diese Rituale der Höflichkeit die Kontaktaufnahme
erleichtern.
Im Tagebuch taucht aber wie in vielen anderen Punkten das
Problem der oberflächlichen Schilderung auf. Das Zeremoniell wird
in allen Einzelheiten – von gesprochenen Gebeten, Bedienungs- und
Trinkritualen bis zum Einsatz verschiedener Servietten – beschrieben,
ohne ein Wort über Gespräche und Charakter der Gäste zu
erläutern.
Dennoch soll allein die Festhaltung zahlreicher Ehrbezeugungen
als Zeugnis für diesen Aspekt herhalten:
„Die Stadt ließ die Herren von Estissac und
Montaigne, um sie zu ehren, für ihr Souper vierzehn Krüge mit
einheimischen Wein von sieben livrierten Stadtsoldaten und einem ehrenwerten
Offizier überbringen. Den Offizier luden wir zum Souper ein, denn
es ist Sitte, ebenso wie wir den Trägern etwas schenkten, wir gaben
ihnen einen Taler. […]Die erwähnte Ehrung wurde uns in allen
deutschen Städten zuteil“[15]
Hier wird eine der wenigen Ehrungen geschildert, wo nicht
nur „genommen“, sondern auch „gegeben“ wird.
Anders die meisten anderen Besuche, wie beispielsweise der
im Landhaus des Fürsten von Florenz, bei dem er einen Teil der Zimmer
sieht: „Es sollen sechsundzwanzig möblierte Zimmer darin sein;
wir sahen davon zehn bis zwölf, die sehr schön waren.“[16]
Oder bei einem Diner eines Großherzogs. „Die
Herren von Estissac und Montaigne waren zum Diner des Großherzogs,
wie er dort heißt, geladen. Die Großherzogin hatte den Ehrenplatz,
dann kamen der Großherzog und die Schwägerin der Großherzogin
mit ihrem Mann, dem Bruder der Herzogin.“[17]
In weiterer Folge werden noch die Tischsitten erzählt, doch steht
nichts mehr von einer Art Gegenleistung oder gar Geschenk der Gäste
zu lesen. Auch beim nächsten Treffen geht die Ehrerbietung nur vom
Gastgeber aus:
„Am letzten Dezember speisten beide Herren [Estissac
und Montaigne] beim Herrn Kardinal von Sens [Nicolas de Pelvé]
zu Mittag, der mehr als jeder andere Franzose das römische Zeremoniell
einhält. […]…vor diejenigen, welche eine besondere Ehre
erfahren sollen, d.h. welche neben oder gegenüber dem Hausherrn sitzen,
werden große viereckige silberne Geräte mit dem Salzfaß
gestellt, von der gleichen Form, wie sie in Frankreich auf den Tisch der
Großen kommen.“[18]
Nach der Beschreibung einer komplizierten Zeremonie, in
der Wein und Wasser von einem Diener gereicht werden, und nur besonders
verdienstvollen Personen zuteil wird, kommt der entscheidende Hinweis
auf eine besonders verdienstvolle Person:
„Man brachte auch dem Herrn von Montaigne, wie es
gewöhnlich beim Herrn Gesandten Brauch war, wenn er dort aß,
auf diese Weise zu trinken: es wurde ihm ein silbernes Becken hingehalten,
in dem ein Glas mit Wein und eine kleine Flasche voll Wasser in der Größe
der Flaschen, in denen man Tinte verwahrt, standen. Er nimmt das Glas
mit der rechten Hand, mit der linken die Flasche und gießt so viel
Wasser wie ihm paßt in sein Glas, worauf er die Flasche wieder in
sein Becken stellt. Sooft er trinkt, hält ihm der Diener das Becken
unters Kinn und nimmt ihm dann das Glas ab, um es ins Becken zurückzustellen.
Es ist ein Vorzug, der nur einer oder höchstens zwei Personen zuteil
wird, die dem Herrn im Rang nachstehen.“[19]
Weitere Einladungen folgen, die stets mit entsprechend hoher
Stellung beschrieben werden:
„… Messer Tadeo Rospigliosi, der aus Rom von
Giovanni Franchini einen Brief mit einer Empfehlung für mich erhalten
hatte, lud mich auf den nächsten Tag zum Essen ein, ebenso wie die
übrigen Teilhaber meiner Gesellschaft.“[20]
„Am Montag aß ich bei Herrn Silvio Piccolomini
zu Mittag, der wegen seiner Verdienste, aber auch wegen seiner Kenntnisse
im Fechten, sehr bekannt ist. Es wurde von vielem gesprochen, da eine
ordentliche Gesellschaft von Edelleuten da war. […] Er behauptet,
in der gewöhnlichen Art des Unterrichts sei weder Regel noch Verständnis;
vor allem verwirft er den Gebrauch, den Degen vorwärts zu stoßen,
stehenzubleiben und sich dabei dem Gegner ausliefern, um dann nach dem
Stoß einen neuen Ausfall zu machen: Die Erfahrung lehrt, daß
Männer, die wirklich kämpfen, es ganz anders machen.“[21]
Montaigne geht mit seinen Meinungen konform, d.h. auch was
„richtige Männer“ sind und wie man sich in einem Kampf
verhalten sollte.
Er wird also auf seinen Reisestationen von der creme de
la creme empfangen, in der er jedoch – wie bereits erwähnt
– immer nur eingeladen wird, ohne ein Geschenk oder sonstige Aufwartung
dem Gastgeber mitzubringen.
Die Ehrerbietung an seine Person gipfelt bei seinem Rom-Aufenthalt,
wo er vom Papst persönlich empfangen wird und an allerlei Tafeln,
wie nur wenig andere Gäste, ehrenvoll bewirtet wird. Dieser Besuch
beim Papst - Gregor VIII - in Rom wir auf über zwei Seiten im Tagebuch
beschrieben. Ein in gelehrten Studien unterrichteter Edelmann, Herr von
Abain, vermittelt eine Audienz mit dem Papst. In der genau geplanten Zeremonie
durften die Reisenden „den roten Pantoffel mit dem weißen
Kreuz“[22] des Papstes küssen.
Ehrenwerte Personen (z.B. Kardinäle) müssen bei der Begrüßung
des Papstes nicht, wie es das Volk tut, auf die Knie sinken – sie
empfangen ihn mit einer tiefen Verneigung des Kopfes.
Neben vielen anderen Einladungen wird Montaigne beschenkt
(„Von mehreren Privatleuten wurden mir Aufmerksamkeiten erwiesen:
Wein, Früchte und Geschenke in Silber [oder Geld (argent)].“
[23]) und sogar Geld angeboten („Sonntag,
den 12.November, lud mich der Herr Alberto Giachinotti aus Florenz, der
mir auch andere Höflichkeiten erwies, zum Essen in sein Haus ein
und bot mir auch an, mir Geld zu leihen, obwohl er mich bis dahin nicht
gekannt hatte.“[24])
Ein weiterer Höhepunkt an Ehrerbietung ist zweifelsohne
die Wahl zum Bürgermeister in Bordeaux, wobei ihm die Nachricht in
Rom übermittelt wird:
„Am gleichen Morgen erhielt ich einen von Rom nachgeschickten
Brief des Herrn du Tausin, der am 2.August in Bordeaux geschrieben war
und mir mitteilte, daß ich am Tag vorher einstimmig zum Bürgermeister
dieser Stadt gewählt worden sei; und ich wurde gebeten, das Amt meiner
Heimat zuliebe anzunehmen.“ [25]
„Am Tage, als ich nach Rom kam, empfing ich Briefe
der Schöffen von Bordeaux, die mir sehr höflich von meiner Wahl
zum Bürgermeister ihrer Stadt Mitteilung machten und mich dringend
baten, möglichst bald zurückzukommen.“ [26]
Eine Ausnahme der vielen Ehrerbietungen ohne Gegenleistung
vollzieht sich anlässlich der Eröffnung der Bade-Saison bei
einem ausgiebigen Ball, zu dem Edelleute und ihre Damen von Montaigne
aus benachbarten Bädern eingeladen werden. Dabei werden Preise für
die besten Tänze vergeben. Montaigne will diese Vergabe an die Edeldamen
abtreten, die dies aber als zu große Ehrerbietung sehen und ablehnen.
Er erweist sich als guter, standesgemäßer, höflicher Gastgeber;
zumindest beschreibt er sich selbst, dass er sich Mühe gegeben hat,
um ein solcher zu sein.
„Nach Tisch gab ich einen Ball mit öffentlichen
Preisen, wie man es gewöhnlich hier im Bade tut, und ich wollte damit
die Saison dieses Jahres eröffnen.“[27]
Montaignes „Ehre“ ist also so strukturiert,
dass er hauptsächlich Ehre in Form von Einladungen und Schenkungen
empfängt und selten – mit der eben beschriebenen Ausnahme –
anderen Personen Ehre zuteil werden lässt. Es soll beim Leser der
Eindruck entstehen, einen besonders verdienstvollen Mann auf seiner Reise
begleiten zu dürfen, der überall bis in die höchsten Kreise
ein gern gesehener Gast und Mitmensch ist. Die Schar der Gastgeber reicht
von berühmten Fürsten bis zum Papst. Leider wird bei diesen
Schilderungen viel zu wenig ins Detail gegangen, so dass spezifischere
Aussagen über vielleicht verbale gegenseitige Ehrbezeugungen nicht
getroffen werden können. Ich denke dabei an inhaltliche Angaben über
einen Gesprächsverlauf an den vielen besuchten Tafeln, die diesen
Aspekt der „Ehre“ um einiges genauer hätten darstellen
können. So bleibt vordergründig der Verdacht stehen, Montaigne
hat auf seiner Reise mehr oder minder einseitige Sozialbezüge hergestellt,
sich bewirten und beschenken lassen und wenig zurückgegeben.
Religiosität
Bei diesem Aspekt sollte anhand des Tagebuches geklärt
werden, wie sich die Religiosität Montaignes im Speziellen darstellte,
welchen Zugang und welchen Platz sie in seinem Leben hatte.
Montaigne hat sich mit der katholischen Kirche seines Landes
nie angelegt oder sie direkt angegriffen; auch wandte er sich in seinen
Texten gegen die Reformation und deren Anhängern.[28] Diese Bekenntnisse
waren jedoch nicht ganz ehrlich. In seinem Arbeitszimmer gab es für
jeden Besucher lesbar einige „christliche“ Inschriften an
den Deckenbalken, die in ihrem Inhalt eher nicht-jüdisch und damit
auch nicht christlich, sondern hellenistisch sind und den irdischen Lebensgenuss
empfehlen.
Interessant die Tatsache, dass ein öffentliches humanistisches
Engagement und eine geistige Öffnung gegenüber den neuen Ideen
in dieser Zeit das Leben kosten konnte. Die schlimmen Folgen der Inquisition
werden an einigen Fällen drastisch geschildert. Montaigne jedenfalls
gelang es, sein theoretisches Heidentum unter einem demonstrierten praktischen
Christentum zu verstecken und so vom Scheiterhaufen verschont zu bleiben
– bis zu seinem natürlichen Tod im Jahre 1592.
Möglicherweise findet sich aus diesem Grund auch kein
Kommentar zu folgender Aussage, wo Katholiken und Protestanten den Bund
der Ehe schließen:
„Heiraten zwischen Katholiken und Protestanten finden
täglich statt, und der Teil, der am meisten Verlangen hat, nimmt
den Glauben des anderen an; solche Ehen bestehen zu Tausenden; unser Wirt
zum Beispiel war Katholik, seine Frau Protestantin.“ [29]
Man kann über die Gläubigkeit Montaignes lange
streiten, doch ein Gottsuchender war er sicher nicht.[30] Er hat zwar
seine Glaubenspflichten ehrlich und ernstlich erfüllt, aber weniger
als Ausdruck seines eigenen Wesens, sondern mehr als das in seinem ihm
durch Geburt und Herkunft zugewiesenen Lebenskreis üblichen Verhalten.
Die Religiosität wird zwar im Allgemeinen – wenn er beispielsweise
vom Tischgebet oder Messgang berichtet - viel eingeflochten, doch wo er
wirklich bei sich selbst einkehrt, also wo er von seinem Leben und Sterben
spricht, bleibt der Glaube draußen.
Es hat sich auch die im Mittelalter unverrückbare Tatsache,
Gott als Geber aller guten Gaben zu sehen, geändert.[31]
Gerade bei Montaigne tritt diese unumschränkte Frömmigkeit zurück,
um einer Naturfrömmigkeit Platz zu machen. In seinen Texten ist zu
Beginn noch die Unschlüssigkeit zwischen dem „Geber“
zu beobachten, die alsbald aber nur mehr von der Natur als großen
und allmächtigen Geber abgelöst wird. Diese Natur ist nicht
eine Kraft, die uns von außen beherrscht, sondern etwas, das in
uns wirkt und als solches direkt erfahrbar ist. Montaignes Frömmigkeit
ist demnach nicht die Frömmigkeit gegenüber einem transzendenten
Gott, sondern gegenüber dem, was wir innerweltlich und vor allem
in uns selbst als „gebend“ erfahren – sozusagen eine
weltliche Frömmigkeit, ein Gottvertrauen fast ohne Gott.
Im Zusammenhang damit steht Montaignes Auffassung über
Wunder.[32] Laut konventioneller katholischer
Auffassung waren Wunder Außerkraftsetzungen der Naturgesetze auf
besondere Anweisung Gottes. Für Montaigne hingegen folgten diese
Wunder aus der schlechten Kenntnis der Natur. Seltsame Ereignisse werden
für Wunder gehalten, aber die Ansichten darüber, was seltsam
ist, sind notwendigerweise ethnozentrisch. Die Kirche behauptet also diese
Erscheinungen als Wunder zu klassifizieren, indes Montaigne meint, nicht
mit Sicherheit sagen zu können, ob es sich um ein Wunder handelt
oder nicht. Radikaler interpretiert könnte man auch sagen, dass für
Montaigne die ganze Vorstellung von „Wundern“ bedeutungslos,
weil ethnozentrisch, sei.
Die Menschen seiner Zeit waren von Wundern beeindruckt.
Montaigne hielt nicht viel davon, vielmehr versuchte er, die Wunder auf
natürliche Phänomene zurückzuführen. Er meint, dass
sie aus relativ nichtigen Anlässen entstehen und in weiterer Folge
in der Art einer Massensuggestion verlaufen.[33]
Die meisten Menschen nahmen hin, was ihnen als Aberglaube
oder zu glaubende Wahrheit aufgegeben wurde. Montaigne hat diese Leichtgläubigkeit
und Manipulierbarkeit der Unwissenden und Ungebildeten bedauert –
meistens werden Frauen, Kinder, Kranke und Greise sowohl von kleinen Gaunern
und Bauernfängern als auch Menschen mit höherem Ansehen (Ärzte,
Priester, …) an der Nase herumgeführt. Es wird nichts so fest
geglaubt, wie das, worüber die Menschen am wenigsten Bescheid wissen.
Hinzu kommt, dass unter dem Deckmantel des Glaubens viele
Kriege und vor allem Landeroberungen legitimiert wurden. Seit der Antike
haben die Heerführer ihren Soldaten gegenüber behauptet, irgendwelche
Eingebungen, Wunderzeichen und Prophezeiungen hätten sie dazu bewogen,
diesen oder jenen Plan umzusetzen.[34]
Montaigne erzählt von einem Friedhof in der Toskana,
wo sich in den ersten acht Stunden die „beigesetzten Leiber derart
aufblähen, daß der Boden sich hebt; in den nächsten acht
würden sie zurückgehen und in den letzten acht zersetzten sich
die Fleischteile so schnell, daß nach Ablauf von vierundzwanzig
Stunden nur noch das nackte Gebein übrig sei. Dies Wunder hat Ähnlichkeit
mit dem auf dem Kirchhof in Rom, wo die Erde jeden Körper eines Römers,
der etwa dort beigesetzt wird, wieder ausstößt.“ [35]
Montaigne beschreibt dann zwar eine Legende, in der durch
ein Wunder – er wurde unsichtbar - ein Mann von Räubern entkommen
konnte, jedoch kein Kommentar, ob er daran glaubt oder nicht.
„Die lateinische Inschrift besagt, daß vor ungefähr
hundert Jahren ein Mann, von Räubern verfolgt und halbtot, sich zu
einer Eiche geflüchtet habe, an der sich dieses Bild der Madonna
befand; er flehte sie an und wurde durch ein Wunder für die Räuber
unsichtbar und entkam so der nahen Gefahr. An dieses Wunder knüpft
sich die besondere Verehrung dieser Madonna.“[36]
Um die eingangs aufgestellten Fragen zu beantworten, kann
man zwar weniger von der Quelle selbst als vielmehr von den vielen Biographien
und Aussagen Montaignes in seinen „Essais“ die Aussagen treffen,
dass die Religion im Gegensatz vieler seiner Zeitgenossen nicht den erwarteten
hohen Rang einnahm. Sein Zugang war ohne Zweifel einer der Vernunft, der
nicht grenzenloses Gottvertrauen aufbrachte, um gewisse Dinge zu erklären.
Auch die im Tagebuch geschilderten Wunder, wenngleich er ebendort keine
Stellung bezieht, können rationell gedeutet werden. Montaigne schenkt
in vielen Fällen der Natur das Vertrauen.
Frauen
Will man das Männlichkeitsverständnis eines Mannes
analysieren, darf ein Kapitel über Frauen nicht fehlen. Interessant
wäre zu erfahren gewesen, welches Bild er sich vom anderen Geschlecht
konstruiert hatte.
Die Beziehung zu Frauen war bei Montaigne nicht sehr intensiv:
„Nüchterne Vernünftigkeit in der Ehe, die er achtet, wie
man eine nützliche Einrichtung achtet.“ [37]
Er berichtet von seiner Ehe, dass er sie nicht aus eigenem Entschluss,
sondern auf fremdes Anraten hin eingegangen ist, da sein Unabhängigkeitsdrang
zu ausgeprägt war. Montaigne sieht in der Frauenliebe kaum mehr als
ein körperliches Geschäft, wird aber dennoch nie plump oder
frauenfeindlich. Die Sexualität sieht er sehr maßvoll: erotische
Befriedigung ob ihrer gesundheitsfördernden Wirkung; in seinem Essais
schreibt er witzig: „Ich finde es leichter, sein Leben lang ein
Panzerhemd zu tragen als eine Jungfernschaft.“[38]
Eine große Liebesleidenschaft kannte und wollte er nicht, da sie
ihm seine Freiheit und maßvolle Mitte geraubt hätte, obwohl
er in seiner Jugend leidenschaftliche Eroberungen und Liebesaffären
gekannt hatte.[39] Er spricht auch nie
von seiner Frau und seinen Kindern.
Dennoch finden sich im Tagebuch viele Versuche Montaignes,
die Schönheit von Frauen zu beurteilen und zu vergleichen, was einen
absoluten Maßstab voraussetzt.[40]
Die Aussage „Wir sahen kein einziges schönes
Frauenzimmer.“ [41] ist in vielerlei
Ausformungen sehr häufig im Tagebuch anzutreffen; in Ancona „sind
die Frauen meist schön“ [42] und in Fano ist „die Stadt
vor allen italienischen Städten für die Schönheit ihrer
Frauen berühmt: Wir sahen keine anderen als ganz hässliche,
und als ich deswegen einen Ehrenmann aus der Stadt fragte, meinte er,
die Zeiten seien vorüber.“ [43]
Frauen gehören zur ästhetischen Ausstattung einer
Stadt; sie werden aber nur beobachtet. Das Tagebuch berichtet über
keine Gespräche mit Frauen, obwohl sich Montaigne alle Mühe
gegeben hat, zum Beispiel mit Kurtisanen Kontakt aufzunehmen, um in den
Genuss ihrer Konversationskunst zu kommen – dabei ist er jedoch
weniger erfolgreich.
In Rom kann er keine aufregenden Frauengestalten entdecken,
obwohl dieser Stadt ein besonderer Ruf vorauseilt – die besondere
Schönheit befindet sich bei denjenigen, „die daraus einen Handel
machen“.[44]
Montaigne beschreibt die römischen Edelfrauen, die
hier im Unterschied zu Frankreich keine Masken tragen und sich unverhüllt
zeigen. Er sah aber mit wenigen Ausnahmen nichts Hervorstechendes. An
den öffentlichen Plätzen – im Wagen, auf Festen, im Theater
- sind sie von den Männern getrennt, wenngleich es Tänze gibt,
„wo die Geschlechter recht frei miteinander in Berührung kommen
und wo es Gelegenheit zu Gesprächen und Handrücken gibt.“
[45]
Weiters berichtet er über den Reiz, den die Kurtisanen
am Fenster ausstrahlen:
„Um die Wahrheit zu sagen, so hat man weiter nichts
davon, als daß man die Damen an den Fenstern gesehen hat und vor
allem wieder die Kurtisanen, die sich an ihren Jalousien mit einer so
durchtriebenen Kunst zu zeigen verstehen, daß ich mich oft verwundert
habe, wie sie unserem Blick auf sich zu ziehen wissen: oft, wenn ich vom
Pferde sprang und es erreichte, daß mir geöffnet wurde, konnte
ich darüber staunen, wie viel hübscher sie am Fenster scheinen
als sie in Wirklichkeit waren. Jede versteht ihren verlockendsten Reiz
sichtbar zu machen, zeigt nur die obere Hälfte des Gesichtes, oder
die untere oder das Profil, die eine ist verhüllt, die andere gar
nicht: kurz, man sieht nicht eine einzige häßliche am Fenster.
Und die Männer scheinen nur auf der Welt zu sein, um vor diesen Fenstern
den Hut zu ziehen, tiefe Verbeugungen zu machen und im Vorübergehen
einen feurigen Blick zu erhaschen.“ [46]
Die Prostituierten dürften wahrlich eine große
Ausstrahlung auf Montaigne ausgeübt haben, denn die Schilderungen,
in denen er von ihnen beeindruckt ist, häufen sich:
„Am gleichen Tag machte ich mir das Vergnügen,
den Damen einen Besuch zu machen, die das niemand verbieten.“ [47]
Montaigne beschreibt die Ausstattung der öffentlichen Frauenzimmer,
die ihn aber ebenso wie die Schönheit der Damen weniger als die römischen
oder venezianischen beeindrucken.
„Die Prostituierten zeigen sich in Florenz nicht an
den Fenstern, sondern bieten sich hier auf offener Straße an.“
[48]
Von seinen Essais ist im Zusammenhang mit Freundschaft seine
Distanz gegenüber Fremden bekannt.[49]
Er widersetzt sich also Neigungen, die von ihm selbst ablenken und an
Fremdes binden; das Größte in der Welt sei, sich selbst gehören
zu können. Eine Ausnahme war sicher die Freundschaft zu La Boétie,
die er ohne Selbstverlust, ja im Gegenteil dank dieser Freundschaft erst
zu sich selbst gefunden zu haben. Der Umgang mit dem Freund hat das Einmalige
an sich, dass man sich jemandem mitteilen kann, der nicht ein Anderer
ist, sondern jemand, mit dem man sich eins fühlt, der zum eigenen
Ich gehört.
Montaigne wusste, dass es Gesellschaften gab, wo Männer
Prostituierte waren und Frauen in den Krieg zogen.[50]
Er folgerte daraus einen geringen Unterschied zwischen ihnen – außer
durch Erziehung und Sitten. Sonst sind sie aus dem gleichen Stoff gemacht.
Es zeichnet sich daher auch in der Herrschaft des Mannes über der
Frau weniger die Natur als vielmehr eine Art Machtergreifung verantwortlich.
Zusammenfassend kann man anmerken, dass Montaigne zwar kein
Beziehungsmensch – zu Frauen (denn seine intensive Männerfreundschaft
mit La Boétie war ihm sehr viel wert) – war, er aber dennoch
reichlich Gefallen am anderen Geschlecht fand, was die zahlreichen Eintragungen
dieses Tagebuchs unter Beweis stellen. Vor allem die käuflichen Damen
dürften es ihm angetan haben – zumindest die Beobachtung derselben.
Leider wird auch zu dieser Frauenthematik nichts über Gespräche
berichtet, die er möglicherweise geführt hatte. Man(n) ist auch
hier auf Spekulationen angewiesen. Ein relativ plausibler Zusammenhang
zwischen seinem „Beziehungsfrust“ und dem Wohlfallen an den
käuflichen Damen könnte darin liegen, dass er gerade von den
Kurtisanen keine Beziehung erwarten konnte, die ihm in seinen Freiheitsdrang
eingeschränkt hätten. Doch das Tagebuch berichtet ausschließlich
von Beobachtungen Montaignes.
Gasthaus
Wer in der frühen Neuzeit seine freie Zeit nicht zu
Hause verbrachte, suchte ein Wirtshaus auf, ein Vergnügen, dem überwiegend
die Männer nachgingen. Manchmal wurde dort auch zum Tanz aufgespielt.[51]
Gerade im ersten vom Sekretär verfassten Abschnitt
nimmt die Beschäftigung mit Gaststätten relativ breiten Raum
ein. Trotzdem muss man die intensive Beschäftigung mit gastronomischen
Fragen wohl in dem Bedürfnis Montaignes nach leiblichem Wohl und
Bequemlichkeit sehen.[52] Oft werden die
Gaststätten untereinander verglichen: „Die Gasthäuser
fand er viel unbequemer als in Frankreich und Deutschland. […] Die
italienischen Wirtshäuser sind viel schlechter.“ [53]
Da die Beschreibungen – vor allem die Einzelheiten
- der Gasthäuser seit der Tagebuchführung durch Montaigne merklich
weniger wurden, kann man davon ausgehen, dass dieser Raum der Männlichkeit
vielleicht nur vom Diener für wichtig empfunden wurde und eventuell
sogar Teile selbst hinzugefügt hat.
Gelehrtes
Wissen
Hier galt es der Frage nachzugehen, inwieweit Montaigne
am „gelehrten Wissen“ teilgenommen hat, wie etwaige Diskussionen
mit Gelehrten und Theologen abgelaufen sind, sowie die darin enthaltenen
Probleme gelöst wurden.
Es war als Vorverständnis für das Lesen der Quelle
nicht uninteressant zu wissen, dass Montaigne neben seinem „eigentlichen“
Beruf als Schlossherr, Jurist, Bürgermeister, Bürgermeister
und vielleicht auch Soldat sehr belesen und umfassend gebildet war. Er
nutzte offenbar seine humanistisch orientierte Erziehung plus Schul- und
Universitätsausbildung, um zahlreiche lateinisch schreibende („römische“)
Autoren zu lesen.[54] Neben den aufkommenden Nationalsprachen behielt
das Lateinische seinen gehobenen Rang. Das reduzierte Kirchenlatein („Küchenlatein“)
konnte auch von einigen Laien verstanden werden, doch die gehobene lateinische
Sprache des Caesar, Tacitus, Cicero, des Horaz und des Ovid und vieler
anderer römischer Schriftsteller und Geistesgrößen war
inzwischen zur lingua franca, zur internationalen Verkehrssprache der
Intellektuellen geworden.
Montaigne hatte einen deutlichen Bildungsvorsprung gegenüber
den meisten anderen Autoren seiner Zeit, da er von seinen Kenntnissen
der vorchristlichen Naturbeschreibungen und –erklärungen der
Griechen und der von ihnen geistig befruchteten Römer profitierte,
die ihm Einblicke in eine Zeit erlaubten, die noch nicht an den jüdisch-christlichen
Schöpfungsglaubens gekoppelt waren.
Das beweisen viele Hinweise, die Antikes in irgendeiner
Weise zitieren:
„Die Statue ist nicht mehr da, aber aus der Art, periculeis
und ähnliche Worte mit Diphtongen zu schreiben, schloß ich
auf das hohe Alter der Inschrift“ [55]
Diese und ähnliche Äußerungen lassen auf
das fundierte Hintergrundwissen Montaignes schließen, so auch:
„Servius merkt bei Vergil an, es sei das Oliviferaque
Mutusca, von dem er im 7.Buche spricht.“ [56] Oder:
„Ancona bekam von alters her seinen Namen von dem
griechischen Wort für den Winkel, den das Meer an dieser Stelle macht.“
[57]
Montaigne hebt Weisheit von „Wissen“ im Sinne
von Gelehrtheit ab, denn gelehrtes Wissen ist primär etwas Angelerntes,
meistens sogar nur etwas Angelesenes.[58] Auch ein Papagei könnte
zitieren, entscheidend ist vielmehr, wie man selbst urteilt. Die Gedanken
sollten selbst geschöpft werden, ohne sie bei anderen auszuborgen.
Man kann also gelehrt auch aufgrund des Wissens anderer sein, weise hingegen
nur aufgrund eigener Weisheit. Der Unterschied von echter Weisheit und
bloßem Wissen ist also der Gegensatz von wirklichem Eigentum und
Fremdbesitz; deswegen sollte auch jeder erkennen, was er ist und was ihm
eigen ist, um fremdes Werk nicht für das seine zu nehmen sowie sich
vor allem selbst zu fördern.
Interessant und von Bedeutung wäre gewesen, wie Gelehrtengespräche,
die er zweifellos hatte, inhaltlich abgelaufen sind. Davon bleibt dem
Leser aber viel verborgen. Gegen Anfang des Reisetagebuchs wird der Schatzmeister
der Stefanskirche in Meaux, Juste Terruelle, aufgesucht, der sicher viel
zu erzählen gehabt hatte, war er doch zehn Jahre in Konstantinopel
sowie längere Zeit auf Reisen im Orient. Montaigne jedoch beschreibt
dem Leser den Garten, ohne auf den Inhalt des Gesprächs einzugehen.[59]
Ähnlich dürftig wird der Inhalt der Gespräche mit dem berühmten
spanischen Jesuiten Jean Maldonat, einem gelehrten Bibelexegeten, beschrieben.
Eine Ausnahme bildet ein Abendessen beim französischen
Gesandten in Rom mit anderen Gästen, wo er die Unterhaltung auf die
französische Übersetzung des Plutarch führt und im Gegensatz
zu den anderen Gelehrten eine andere Meinung vertrat:
„Eines Tages, als ich in Rom bei unserem Gesandten
mit Muret und anderen Gelehrten speiste, brachte ich die Rede auf die
französische Übersetzung des Plutarch und blieb gegenüber
denjenigen der Herrn, die sie weit geringer als ich schätzten, wenigstens
darin bei meiner Meinung, daß der Übersetzer überall,
wo er den wahren Sinn Plutarchs verfehlt hat, der mit dem, was vorangeht
und nachfolgt, zusammenpaßt. […]Der Übersetzer hat wirklich
den Sinn verfehlt, denn das griechische Wort bedeutet bestimmte Zeichen,
die an verpfändeten und belasteten Ländereien angebracht wurden,
damit die Käufer von der Hypothek Bescheid wussten“ [60]
Es stehen hier also nicht die Gelehrten, sondern der Gesprächsverlauf
und Montaigne im Vordergrund.
Manchmal erscheint in seinen Reiseschilderungen auch ein
zarter Hinweis auf das „Wissen“ seiner Mitmenschen. Er wohnt
der ältesten religiösen Zeremonie bei: der Beschneidung der
Juden. Dabei ist er von der Beredsamkeit und dem Verstand des Redners
sehr angetan.
„Derjenige, den wir anhörten, schien dem Herrn
von Montaigne viel Beredsamkeit und viel Verstand in seinen Beweisgründen
zu entfalten.“ [61]
Vom Geist und Verstand der Italiener ist er weniger angetan:
„Ich fand keine außergewöhnliche Fähigkeit; dafür
machen sie zu viel Aufhebens von dem wenigen, was wir selbst taugen.“
[62]
Verschiedene Begegnungen mit Gelehrten bereichern das Wissen.
Montaigne beschreibt sich selbst als wissbegierig. „Da ich immer
wieder den Ort wechselte, ging mir der Stoff, der meine Wißbegierde
befriedigte, nie aus.“ [63]
Leider hat auch dieser Punkt die Erwartungen, in der Quelle
fündig zu werden, nicht zur vollsten Zufriedenheit erfüllt,
da mit Ausnahmen wenig über Gesprächsinhalte publiziert wurde.
Mann - Männlichkeit
Wie stellt sich Montaigne selbst als Mann dar? Wie sieht
er andere Männer? Wie offen spricht er heikle Themen an? Wo ist die
Grenze des Schamgefühls? Diese und weitere Fragen stellte ich mir
hinsichtlich dieses Kapitels, da vielleicht auch dazu beitragen konnte,
das „männliche“ Bild Montaignes zu erhellen.
Montaigne schreibt zumindest in der „Essais“
oft über nicht immer heldenhafte Gefühle (angesichts drohender
Verwundung und Tod in kriegerischen Auseinandersetzungen), also auch über
„peinliche“ oder auch nur „schäbige“ Themen,
über die „man“ sich eigentlich nicht so frei zu äußern
pflegte. Auch wenn ihm seine Redlichkeit Überwindung kostete, ihn
in einem schlechten Licht erscheinen lassen könnte – Montaigne
wollte so weit wie möglich offen sein, d.h. soweit es ihm nicht das
Leben kostete.[64]
Die einzige Beschreibung über andere Männer lässt
diese nicht sehr gut aussehen:
„Die Männer sind, bei welcher Gelegenheit es
auch sei, sehr einfach in schwarzes Florentiner Zeug gekleidet; und da
sie etwas dunkler als wir sind, so machen sie, ich weiß nicht wie,
nicht den Eindruck von Herzögen, Grafen und Marquis, wenn sie es
auch sind, sondern sehen ein wenig gewöhnlich aus…“ [65]
Montaigne ist vor allem bei seinen direkt ins Tagebuch eingeflossenen
Bemerkungen (ab Seite 189) zum Teil in seiner Ausdrucksweise sehr unverblümt.
Die genaue Beschaffenheit seines Urin und Kots wird dem Leser in allen
Einzelheiten näher gebracht.
So ist auch die genaue Schilderung einer Beschneidung wie
folgt zu lesen:
„…nimmt der Operateur das Glied des Knaben,
zieht die darüber befindliche Haut mit der einen Hand zu sich heran,
während er mit der anderen die Eichel und das Glied zurückdrückt,
…“ [66]
Oder über die Art einer homosexuellen Eheschließung:
„In dieser Kirche hätten verschiedene Portugiesen
vor ein paar Jahren eine merkwürdige Bruderschaft gegründet.
Sie schlossen Mann mit Mann bei einer Messe die Ehe unter denselben Zeremonien,
die wir bei unseren richtigen Trauungen anwenden, gingen gemeinschaftlich
zum Abendmahl, lasen den bei Eheschließungen üblichen Text
des Evangeliums und zogen dann zusammen, um beieinander zu schlafen und
zu wohnen. […] Acht oder neun Portugiesen dieser schönen Sekte
wurden verbrannt.“ [67]
Am häufigsten werden jedoch seine Krankheitsgeschichten
berichtet: „Damit konnte ich endlich, …, den Stein ganz ausscheiden.
Er war groß und lang wie ein Tannenzapfen, aber an einem Ende dick
und von der Gestalt einer Bohne – um die Wahrheit zu sagen, er hatte
vollständig die Form eines männlichen Gliedes.“ [68]
Viele stichhaltige Erkenntnisse hat auch dieser Punkt
nicht eingebracht. Die teilweise unverblümte Wortwahl in seinen Ausführungen
lässt einen freien, offenen Mann erkennen, der die Dinge zumindest
verbal enttabuisiert.
Verhältnis
zu seinem Diener
Das Verhältnis Diener/Herr hat mich insofern beschäftigt,
als ich die Hoffnung hegte, darin entweder eine Männerfreundschaft
ob der vielen miteinander verbrachten Zeit oder einen platonischen Ehefrau-Ersatz
zu entdecken, wenngleich mir natürlich bewusst war, dass dies die
Rangdifferenz verhindern hätte können.
Da in dem gesamten Text keine Ehefrau Montaignes vorkommt,
hat möglicherweise Montaignes Diener die Funktion seiner Ehefrau
übernommen, der die normalerweise in der Hausgemeinschaft festgelegten
Aufgaben wie die vom Mann erworbenen Güter zusammenzuhalten oder
für Ordnung zu sorgen, erledigte. Auch durfte die gute Ehefrau sich
nicht den Sitten und dem Willen eines selbst launischen Ehemannes entgegenstellen.
Alles Aufgaben, die dem eines oder diesen Dieners ähnlich waren.
Weitere Spekulationen hinsichtlich einer spezielleren Funktion
des Dieners lassen sich nur schwerlich anstellen, da Montaignes Sekretär,
wenn man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann, im Gegensatz
zu Sekretären anderer Reisender gänzlich anonym geblieben ist.
Montaigne erwähnt ihn ein einziges Mal, als er ihn als Schreiber
ablöst[69] : „Da ich denjenigen unter meinen Leuten, der dies
schöne Geschäft besorgte, verabschiedet habe, will ich, in Anbetracht,
daß es schon so weit vorgeschritten ist, trotz der Unbequemlichkeit,
die damit für mich verbunden ist, die Fortführung selbst übernehmen.“
[70] Daraus geht leider nicht hervor, welche Beziehung zwischen Montaigne
und ihm bestand und warum er überhaupt mit dem Schreiben aufgehört
hat. Möglicherweise hat sich der Schreiber zu Beginn des Tagebuchs
vorgestellt; die ersten Seiten sind jedoch verschollen, was wiederum keine
eindeutigen Interpretationen zulässt.
Dem Sekretär jedenfalls ist zu verdanken, dass im ersten
Teil wesentlich ergiebigere Informationen über Montaigne vermittelt
werden: im zweiten von Montaigne geschriebenen Teil beobachtet er nicht
sich selbst, wenn er etwas aufschreibt, indes der Sekretär auch die
Reaktion des Beobachters festgehalten hat.
Allfällige weitere Interpretationen in der Literatur
befassen sich zwar teilweise mit der Rolle und Identität des geheimnisvollen
Sekretärs, führen aber im Hinblick auf das zu erörternde
Thema zu keinem Ergebnis.
ZUSAMMENFASSUNG
Nach Abschluss der Lektüre kam das Gefühl auf,
das Reisetagebuch gar nicht gelesen zu haben – so nichts sagend
waren die meisten Passagen, dass kein Grundtenor hängen geblieben
ist. Mit Hilfe der vielen Bibliografien sind dann beim nochmaligen Lesen
einzelner Abschnitte gewisse Muster entstanden, die mir jedoch kein eindeutiges
Männlichkeitsbild von Montaigne im Allgemeinen und hinsichtlich seiner
Badereise im Speziellen liefern konnten. Einige Aspekte möchte ich
dennoch zusammenfassend anführen: Montaigne war ein Mann, dem auf
seiner Reise viel Ehre zugetragen wurde, ohne, dass er in gleichem Ausmaß
sie zurückgegeben hätte. Es war also mehr „nehmen“
als „geben“.
Andere Merkmale sind sicher die freie, offene Art, in der
er Dinge auszusprechen wagte, die für viele tabuisiert waren. Nicht
zuletzt möchte ich seinen Zugang zu Religiosität und Glauben
erwähnen, der sich mit seiner Naturfrömmigkeit sehr rationell
ausnahm oder vermutlich zu jener (Neu)zeit etwas ungewöhnlich war.
Die verschiedenen in der Arbeit beleuchteten Aspekte haben
vielleicht ein wenig zur Aufhellung Montaignes beigetragen, doch ein eindeutiges
Männlichkeitverständnis war nicht zuletzt aufgrund der oberflächlichen
Berichterstattung im Tagebuch nicht auszumachen. Leider hat sich der auf
Fakten gegründete Erzählstil in dem Reisebericht wie ein roter
Faden durchgezogen, und somit wenig gründlichere Interpretationen
oder gar Feststellungen ermöglicht, wenngleich die eingangs erwähnten
Hilfen in der Literatur ein skizzenhaftes Männlichkeitsbild und –
verständnis Montaignes entstehen haben lassen.
Anmerkungen
[1]Reto
Luzius Fetz, Montaigne: Selbsterfahrung und Identität, in: Hildegard
Kuester (Hg.), Das 16.Jahrhundert. Europäische Renaissance. Regensburg
1995, 54-56
[2]Michel
de Montaigne, Tagebuch einer Badereise. Stuttgart 1963, 362
[3]Hugo
Friedrich, Montaigne. Tübingen 1993, 238f.
[5]Hermann
Wiedemann, Montaigne und andere Reisende der Renaissance. Trier
1999, 150
[7]Michel
de Montaigne, 139
[8]Michel
de Montaigne, 39
[9]Thomas
Laqueur, Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter
von der Antike bis Freud. Frankfurt am Main/New York 1992, 148
[13]Paul
Münch, Lebensformen in der frühen Neuzeit. Frankfurt am Main/Berlin
1992, 75f.
[32]Peter
Burke, Montaigne zur Einführung. Hamburg 1993, 38f.
[40]Hermann
Wiedemann, 164f.
[59]Hermann
Wiedemann, 162f.
[69]Hermann
Wiedemann, 69
Literatur
Burke, Peter: Montaigne zur Einführung.
Hamburg 1993.
Fetz, Reto Luzius: Montaigne: Selbsterfahrung
und Identität, in: Hildegard Kuester (Hg.), Das 16.Jahrhundert: Europäische
Renaissance. Regensburg 1995, 53-76.
Friedrich, Hugo: Montaigne. Tübingen 1993.
Keel, Daniel: Über Montaigne. Zürich
1992.
Thomas Laqueur, Auf den Leib geschrieben. Die
Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud. Frankfurt am Main/New
York 1992.
Montaigne, Michel de: Tagebuch einer Badereise.
Stuttgart 1963.
Münch, Paul: Lebensformen in der frühen
Neuzeit. Frankfurt am Main/Berlin 1992.
Rieger, Markus: Ästhetik der Existenz?
Eine Interpretation von Michel Foucaults Konzept der ´Technologien
des Selbst´ anhand der ´Essais´ von Michel de Montaigne.
New York/München u.a. 1997.
Schauer, Hans: Michel de Montaigne, ein mutiger
Denker in wirrer Zeit <http://www.laterne-online.de/monotheismus-kritik/michel.html>
Mai 2002
Wiedemann, Hermann: Montaigne und andere Reisende
der Renaissance. Drei Reisetagebücher im Vergleich: Das Itinerario
von de Beatis, das Journal de Voyage von Montaigne und die Crudities von
Thomas Coryate. Trier 1999.
Zweig, Stefan: Montaigne. Frankfurt 1995.
|