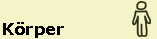|
| |
|
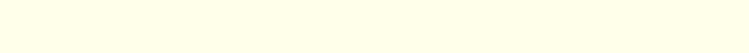
Zitieren sie diesen Text
bitte folgendermaßen:
Kührer, Florian:
Marcello Mastroianni - Autopsie einer Autobiographie. In:
Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts
für Geschichte der Universität Wien,
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/biographien/mastroianni_01.htm
Marcello Mastroianni

Autopsie einer Autobiographie
1 Vorwort
Marcello Mastroianni gehört zu einer neuen Generation von Künstlern.
Er ist Teil der Nachkriegsgeneration, ist also wie die meisten seiner
Zeit vom Zweiten Weltkrieg geprägt. Mastroianni schafft den Sprung
aus der Provinz nach Europa, liebt das Reisen und das Abenteuer. Er schlägt
sich mit dem „latin lover – Image“ herum, das er rundweg
dementiert. Trotzdem war sein Eindruck auf Frauen durchwegs ein anziehender.
Mastroianni steht für eine gewisse Leichtigkeit, für einen unkomplizierten
Zugang zum Schauspielerberuf und stellt sich immer wieder als Anhänger
einer konträren Mentalität zu Hollywood dar.
Marcello Mastroianni steht für eine bestimmte Gesellschaftsschicht
der Nachkriegszeit, für eine neue Männlichkeit, die weniger
von sich selbst verlangt, die einen verspielten Umgang mit dem Schicksal
hat. Europa aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wieder aufzubauen
wäre allein mit Menschen seines Schlages nicht geglückt. Mastroianni
und Seinesgleichen sind aber Wegbereiter in eine neue, kosmopolitische
Zeit, aber auch in ein Europa der Regionen.
2 Familie und Heimat
Herr Professor, wenn ich manchmal nicht einschlafen
kann, stelle ich mir vor, ich würde mich im Ersten Weltkrieg befinden,
in einer schützenden Höhle, während es draußen regnet.
Wie lässt sich das erklären? (1)
2.1 Kindheit
Mastroianni selbst sagt, dass er nicht den Eindruck eines Muttersöhnchens
erwecken will, stellt aber fest, dass seine Mutter die wichtigste Person
in seiner Kindheit war. Genauso spielen aber auch sein Vater und sein
Großvater eine positive Rolle in seinem Leben, auch diese beiden
konnten ihm ein Gefühl von Geborgenheit geben. Mastroianni erweckt
den Eindruck, in einer soliden Umgebung aufgewachsen zu sein. Nur einmal
erwähnt er den Generationenkonflikt, der von Zeit zu Zeit zwischen
seinem Vater und seinem Großvater aufkam. Die Berichte aus seiner
Kindheit sind mit Sicherheit etwas romantischer dargestellt, als sie war,
im Grunde hat er sie aber positiv erlebt.
2.2 Familie und
Beruf
Mastroiannis Eltern begleiteten stolz die Karriere ihres Sohnes, sie gingen
ins Kino, um seine Filme zu sehen. Selber war er jedoch kaum imstande,
eine Familie zu gründen: Ach ja, es ist, als
ob ich immer ein Leben in Klammern geführt hätte, in der Erwartung,
dass irgendwann, später, das richtige Leben beginnen würde,
aber vielleicht (ohne Übertreibung) hat es nie eines gegeben. Gewiss
hat das mein Verhältnis zu den Menschen beeinträchtigt, die
mir wichtig sind. (2) Mastroianni
ist wohl ein sensibler, gefühlvoller Mensch. Er geht aber völlig
in seinem Beruf auf. Seine Emotionen gegenüber seiner Familie konnte
er nie so richtig zum Ausdruck bringen. Ein gewisser Mangel an Sesshaftigkeit
hat dazu sicher beigetragen.
Marcello Mastroianni mochte kleinere Sets in familiärer
Atmosphäre.(3) Seine eigentliche
Familie, die ihn tagtäglich umgab, war wohl das Filmteam, mit dem
er gerade gearbeitet hat.
2.3 Heimat
Schon als Kind wird Marcello Mastroianni vom Fernweh geplagt. Die verlockendesten
Paradiese sind für ihn die, die wir noch nie
gesehen haben, die Orte und Abenteuer, die wir uns vorstellen...die wir
eines Tages erleben werden, wie in einem Traum, der wahr geworden ist.(4)
Er liebt sein Heimatdorf Arpino, Rom, hat italienischen Stolz, ein Nationalbewusstsein
(dem nichts Radikales anhaftet), er fühlt sich aber vor allem als
Europäer, nimmt Europa auch immer als (positiven) Vergleich zu Amerika.
Das Reisen ist seine Leidenschaft, wie ein Baum streckt er die Äste
in den Himmel – seinen Wurzeln bleibt er sich aber immer bewusst.
3 Der Schauspieler
Was für ein merkwürdiges Tier ist der Schauspieler,
der in eine Figur nach der anderen schlüpft, der erfundene Geschichten
erlebt? Wer ist er in Wirklichkeit? (5)
3.1 Handwerk und
Sendung
Es ist eine gewisse Leichtigkeit, die den Stil Marcello Mastroiannis und
wohl den italienischen Film im Gesamten vom Mainstream unterscheidet.
Auf der einen Seite sieht Mastroianni seinen Beruf als Handwerk. Am Beginn
seiner Karriere darf er nicht sehr wählerisch sein, um seine Existenz
zu sichern. Allerdings ist sein erstes professionelles Engagement am Theater
schon drei Mal lukrativer als sein Bürojob. Auf der anderen Seite
bewahrt sich der Schauspieler eine Art von Sendungsbewusstsein, indem
er in seiner Autobiographie oftmals „Schnittstellen“ erwähnt,
die ihn und historischen Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen
des Lebens verbinden:
a) Mastroianni erzählt von seiner Heimat in Italien und lässt
nicht unerwähnt, dass Cicero genau 2122 Jahre vor ihm, aber nur ein
paar Schritte von seinem Zuhause entfernt, geboren wurde.
b) Wenige Seiten später spricht er von Dreharbeiten in einem Schloss
in der Umgebung Londons. Dieses Schloss war zum Museum umgestaltet worden
und in einem Raum stand das Bett, in dem Winston Churchhill zur Welt gekommen
war. Nach ein paar Tagen Dreharbeiten schlief Mastroianni in diesem Bett:
Welchen Schaden habe ich dem Bett zugefügt? Churchhill
wurde darin geboren, und dann hat Mastroianni darin geschlafen.(6)
c) Bei seiner Reise nach New York wird Mastroianni von Lee Strasberg,
dem Leiter des Actors’ Studio, eingeladen. Dort waren laut Mastroianni
alle Schauspieler da, mit Ausnahme von Marlon Brando
waren wirklich alle da. (7)
Genauso wie Mastroianni seine Berufung zum Schauspieler mit dem Bericht
über verschiedenste Begegnungen und „Schnittstellen“
seines Lebens quasi legitimiert, sieht er sich umgekehrt erst durch seine
Arbeit als Schauspieler in der Lage, der internationalen Prominenz zu
begegnen. Er fühlt sich privilegiert, erzählt von Möglichkeiten,
die erst sein Beruf eröffnet: das Reisen, oft in die entlegensten
Winkel der Erde, Begegnungen mit Berühmtheiten, Einblick in Theater-
und Filmkultur.
Mastroianni sieht sich und seine Familie als „einfache Leute“,
er sich also auch als einfachen, umkomplizierten Menschen. Trotzdem sucht
er auch in seiner Verwandtschaft nach dem Konnex zu Kunst und Schöpferischem:
a) Er erwähnt die Hände seines Onkels und bezeichnet sie als
starke „Bildhauerhände“. Seine Familie spielt eine große
Rolle, sein Vater und sein Großvater waren beide Tischler –
Handwerker – und so sieht Mastroianni die beiden, und in einer gewissen
Hinsicht auch seinen Beruf.
b) Gleichzeitig erzählt er von seinem Großvater, dass dieser
stolz gewesen sei auf den Mitbürger Cicero und dass er diesen auch
gern zitiert hätte: „Vitam regit fortuna,
non sapientia“, sagte er zu mir. Dann seufzte er: „Ach ja,
das Glück beherrscht das Leben, nicht die Weisheit.“ (8)
3.2 Täuschung
Immer wieder erwähnt Mastroianni, dass sein Beruf mit Täuschung
zu tun hätte, und nimmt Bezug auf die italienische Sprache: Wir
sagen recitare, rezitieren, und das klingt bereits nach etwas Vorgetäuschtem,
Falschem, Gekünstelten.(9)
Kurz zuvor sagt er, dass ihm das französische Wort „jouer“,
das soviel wie „spielen“ bedeutet, besser gefällt. Mastroianni
meint jedoch, dass fünfzig Prozent der Persönlichkeit des Schauspielers
in die verschiedensten Rollen einfließen, mehr noch findet er es
wahrscheinlich, dass einem Schauspieler viele Rollen gar nicht so fremd
sind wie man denkt. Ein paar Seiten später erzählt Mastroianni
von einem Interview, das er gemeinsam mit Vittorio Gassman gab. Darin
beschreiben sie den Schauspieler als eine leere Schachtel, die man immer
weiter mit Figuren füllt. So verfügt der Schauspieler über
ein immer größeres Repertoire an Rollen und Typen, die er von
Zeit zu Zeit hervorholen kann, um eine Figur zu spielen.
3.3 Freude am Beruf
Markant ist, wie sich Mastroianni über seine amerikanischen Kollegen
amüsiert. Zum einen schlägt seine antiamerikanische Gesinnung
(vor allem Anti-Hollywood) durch und zum anderen beschreibt er wohl so
am genauesten, was seine Einstellung und Philosophie in Bezug auf seinen
Beruf ist. Mastroianni erzählt vom Leiden des Schauspielers, von
den Qualen mancher Mimen, in eine Figur schlüpfen zu müssen:
Die einen schließen sich in einem Kloster ein,
die anderen gehen auf einen Berg, um nachzudenken. (10)
Mastroianni versteht diese Probleme nicht, vergleicht das Schauspielen
mit Kinderspielen, bei denen sie sich ja auch nicht geplagt hätten.
Im Gegensatz zu der laut Mastroianni „amerikanischen“ Einstellung
zeugt er selbst von einer spielerischen Leichtigkeit: Ich
behaupte, diesen Beruf übt man aus, um Spaß zu haben.
(11)
4 Reisender, Abenteurer,
Visionär
Ich erinnere mich an mein Vorhaben, den Tiber anzuheben
und darunter eine Straße zu bauen. (12)
4.1 Reisen und Abenteuer
Für Marcello Mastroianni ist das Reisen die größte Leidenschaft
neben dem Schauspielerberuf. Er ist dankbar, das er durch seine Arbeit
in der Welt herumkommt, er sieht sich in dieser Hinsicht als privilegiert.
Bewusst sucht er sich Drehorte, die ihn an Plätze bringen, die „abenteuerlich“
anmuten. „Ja, ich erinnere mich“ entstand während Dreharbeiten
in den Bergen Portugals. Mastroianni graut vor der Vorstellung, sich bei
Filmen auf keine Wagnisse mehr einzulassen.
Außerdem baut er eine Beziehung zu vielen Städten der Welt
auf:
Paris und Rom: meiner Meinung nach sind das die beiden
schönsten Städte auf der ganzen Welt. (13)
New York gefällt mir sehr.(14)
(N. Y. stellt eine der wenigen Ausnahmen hinsichtlich seiner negativen
Einstellung zu den USA dar.)
Darin besteht die Kraft der Neapolitaner: in ihrem
Charakter, in ihrer Tradition, in der tiefen Verbundenheit mit ihrer Stadt...eine
wahre Hauptstadt des Mittelmeerraumes. (15)
Für Mastroianni ist das Reisen eine Ausfaltung der paradoxen Sehnsucht
nach der Zukunft, in die er bis ins Alter mit Zuversicht blickt. Ein weitere
Mosaikstein in seinem optimistischen Weltbild.
4.2 Visionär
und Weltverbesserer
Marcello Mastroianni hat das Studium der Architektur begonnen, jedoch
keinen Abschluss gemacht. Seit Jahren schon glaubt er daran, dass eine
Untertunnelung des Tiber das Verkehrsproblem Roms lösen könnte.
Überzeugt verteidigt er seine Idee, selbst wenn die Chance auf eine
Realisierung relativ gering ist.
In ähnlich naivem Stil geht er auf die Armut in der Welt ein: Warum
baut man nicht dort Fabriken, Schulen, Straßen, wo man sie braucht?
(16)
Naiv und unrealistisch sind Mastroiannis Lösungsversuche für
die Probleme der Welt: In Dingen des persönlichen Lebens hat Mastroianni
Lösungen parat, aber wenn es um Lösungsansätze für
„globale“ Angelegenheiten geht, tritt er als Phantast auf.
5 Körperlichkeit
und Schönheit
„Ja, die Figur ist nämlich so eine Art
Luftikus. Paul Newman hat dafür zuviel Persönlichkeit.“
„Sehr gut“, sagte ich. (17)
5.1 Körper
und Schauspiel
Mastroianni ist sich bewusst, dass sein Körper ein wichtiges Ausdrucksmittel
ist, besonders in seinem Beruf als Schauspieler. Seiner Meinung nach hat
der Körper eine ganz bestimmte Funktion, er bringt den Gemütszustand
und die Haltung eines Menschen zum Ausdruck. So wie Mastroianni seinen
Beruf als (angenehmes) Handwerk sieht, ist sein Körper das Werkzeug.
Dies ist keine Abwertung, Marcello Mastroianni ist sich seiner Begabung
bewusst. Er ist dankbar für sein Schicksal, für seinen Beruf,
der ihm viele Möglichkeiten eröffnet hat. Trotzdem ist er manchmal
fast verwundert über den Verlauf seiner Karriere: Er selbst meint,
dass seine Nase zu kurz und seine Beine zu dünn seien. Fast schon
amüsiert erzählt er von seinem väterlichen Freund, dem
großen italienischen Regisseur Federico Fellini (1920 – 1993),
der Mastroianni dem Schauspieler Paul Newman vorgezogen hatte, da ihm
dieser zu bedeutend war. Fellini aber wollte mit Mastroianni ein Allerweltsgesicht.
Dieser war nicht beleidigt, sondern stand freudig für den Film zur
Verfügung. Ein anderes Mal sagte Fellini zu Mastroianni, dass er
ein Gesicht wie ein Bauer und auch solche Hände hätte. Um nun
Mastroianni für einen Film intellektueller und zerbrechlicher wirken
zu lassen, schlug Fellini vor, ihm die Brusthaare zu entfernen. Fast schockiert
erzählt der Schauspieler darüber: Also wurden
mir die Haare mit Wachs entfernt, ausgerissen! (18)
Mastroianni sieht sich wohl als einen modernen, sensiblen Mann der gewisse
Sexismen nicht notwendig hat. Trotzdem hat man in diesem Moment den Eindruck,
als käme er sich ohne Brusthaar als „etwas weniger Mann“
vor.
5.2 Sexappeal und
Schauspiel
Zumeist jedoch will er weg vom „latin lover – Image“,
seiner Ansicht nach ist dieses vom amerikanischen Journalismus konstruiert
worden. Er widerlegt es – beleidigt über diese Engführung
– mit einigen Beispielen über gegensätzliche Rollen in
seiner Schauspielkarriere: Nach „La dolce vita“ habe er einen
Impotenten gespielt, später einen „widerlichen, betrogenen
Ehemann“, einen schwangeren Mann und einen Homosexuellen. Mastroianni
hat es nicht notwendig, nur Rollen zu spielen, die den „latin lover“
beinhalten, fast krampfhaft wehrt er sich dagegen. Er weiß aber
um seine „Macht“ in der Welt des Films und des Theaters: Der
Schauspieler ist schließlich der Bindestrich zwischen Autor und
Publikum. Wenn das Publikum von einem Gesicht, einem Körper nicht
fasziniert ist, ist es weniger interessiert an der Geschichte. (19)
Offensichtlich gesteht er sich selbst Sexappeal zu sonst würde er
nicht behaupten, dass er als Schauspieler Karriere
gemacht [hat], nicht als Schönling. (20)
6 Beziehungen und
Liebe
Ich liebe auf long distance, also per Ferngespräch,
per Telefon. Auf diese Weise bleibt man zwar in Kontakt, aber es ist auch
ziemlich abstrakt. (21)
6.1 Beziehungen
und Kinder
Sorgfältig vermeidet er Marcello Mastroianni, seine Beziehungen in
seiner Biographie zu erwähnen. Wohl erzählt er kurz von seinen
Töchtern Chiara und Barbara. Dass aber die eine Tochter aus der Ehe
mit der Schauspielerin Flora Carabella stammt und die andere aus einer
vorübergehenden Beziehung zu Cathérine Deneuve, erwähnt
er nirgends. Ebenso bleibt in der Biographie verborgen, dass seine spannungsreiche
Ehe mit Carabella trotz vieler Affären erst 1990 getrennt wurde.
6.2 Liebe und Liebesleben
Wohl aber misst er der Liebe Bedeutung bei. Seine Männlichkeit ist
eine sensible, zumindest in der Theorie. Mastroianni spricht offen über
die Liebe, bezeichnet sie als „eine Art Kristallisierung“.
Magisch sieht er ihre Wirkung auf den Menschen, er will und kann sie nicht
durchschauen, sieht sie als Geschenk wie vieles in seinem Leben. Ein solches
Geschenk war wohl eine Bahnfahrt in der Zeit der Kriegswirren: Der
Zug fährt in einen Tunnel; es wird stockfinster, und in diesem Augenblick,
während alles ganz still ist, küsst mich eine Unbekannte auf
den Mund.(22) So flüchtig
dieses Erlebnis auch war, es war doch eine prägende erotische Erfahrung.
Immerhin widmet er dieser Begebenheit noch ein ganzes Kapitel.
Der „latin lover“ ist in diesem Kapitel wohl zu vernachlässigen,
da er ja in Mastroiannis Augen eine reine Konstruktion von Journalisten
war. Nur einmal spricht er von seinen Leistungen, wenn er eine Frau kennen
gelernt hat oder ein „Abenteuer“ hatte, er sagt, dass er diesbezüglich
ein „ganz normaler Mann“ sei. Für Mastroianni ist das
Liebesleben eine Privatsache, die selbst das Team, dass seine Autobiographie
mit ihm produziert hat, nichts anging.
7 Bildung und Weltbild
Mein Museum besteht aus den Orten, an denen ich drehe.
(23)
7.1 Bildung und
Kultur
Marcello Mastroianni hatte keine fertige akademische Ausbildung, was ihm
gerade am Beginn seiner Theaterkarriere oft Schwierigkeiten bereitet hat.
Darum musste ihm Schauspielkollege Vittorio Gassmann bei den Proben zu
„Oreste“, einem Versdrama von Vittorio Alfieri, heimlich Lektionen
erteilen, da ihm die Verse große Schwierigkeiten bereitet haben.
Mastroianni erwähnt, dass er neben seinem Beruf wenig Interessen
hätte. Dies lässt darauf schließen, dass weder die Gesellschaft,
in der er sich bewegt, noch er von sich selbst etwas wie großes
Allgemeinwissen oder gar „Universalbildung“ verlangt. Weiter
„gesteht“ er, in „geistiger und kultureller Hinsicht“
nicht sehr bewandert zu sein. Museen, ja selbst Kino und Theater langweilen
ihn, dort hat seiner Meinung nach nur der Schauspieler selber Spaß,
da er sein Bedürfnis, sich zu produzieren, auf diesem Weg befriedigen
kann.
7.2 Weltbild
Nur manchmal klingt in „Ja, ich erinnere mich“ ein Ansatz
von persönlichem Weltbild und Erklärung durch:
New York gefällt mir auch deshalb, weil es gleichzeitig
prachtvoll und heruntergekommen ist. (24)
Heilige und Helden irren sich nie. Wichtig erscheint mir dabei der Zusatz:
(Im Übrigen sind mir Heilige und Helden unsympathisch.)
Es muss Schwankungen geben, ein Auf und Ab. (25)
Mir gefällt diese kleine, stille Welt, bevölkert
von Versagern, die gleichzeitig voller Enthusiasmus, voller Träume
und Illusionen sind. ...Aber das Tragische grenzt bei ihm [Tschechow]
an das Lächerliche, weshalb man auch lachen muss. (26)
Es sind also die Gegensätze, die Mastroianni faszinieren, die Dialektik.
Er lässt jedoch eine Vielfalt an Abstufungen zu. Es ist ein populärer
Ansatz, den Mastroianni nicht konsequent verfolgt, der aber auch vom Zeitpunkt
seiner Autobiographie geprägt ist. Es ist eine resümierende
Sicht, die er im Alter von 72 Jahren hat: Hinter der Welt steht eine Art
von Dualismus. (Meine persönliche, gewagte Frage nun: War es wieder
modern, Gnostiker zu sein und ist sich Mastroianni seiner Denkansätze
bewusst? Oder schwamm er einfach nahezu unreflektiert auf einer Modewelle
mit?)
8 Laster
Ich erinnere mich an meine erste Zigarette. Sie war,
erinnere ich mich, aus den Haaren eine Maiskolbens gemacht. (27)
8.1 Rauchen
Fünfzig Jahre lang rauchte Mastroianni rund 50 Zigaretten am Tag.
Er sieht ein, dass das Rauchen ein schädliches Laster ist, gleichzeitig
schlägt aber seine Abneigung gegen Amerika durch: ...bin
ich den Amerikanern böse: ... Was wollen sie eigentlich? Uns Raucher
in ein Ghetto sperren? Jeder will doch leben und sterben wie er will.(28)
Er vergisst als Mann des öffentlichen Lebens jedoch nicht, zum Schluss
die „richtige“ Botschaft mitzugeben: So:
Es ist wirklich schädlich.
8.2 Autos
Marcello Mastroianni hat in seinem Leben viele Autos besessen. Mit seinem
Freund und Regisseur Federico Fellini (1920 – 1993) wetteiferte
er, wer öfters ein neues Auto kauft. 1996 fragt er sich: Kann
man denn noch blöder sein? (29)
Offenbar werden gewisse („klassische“) Statussymbole, in diesem
Fall viele teure Autos, mit der Zeit uninteressant.
9 Abneigungen
Ich erinnere mich an einen Film, „Tragico ritorno“,
in dem ich in der Fremdenlegion (ausgerechnet!) landete,... (30)
9.1 Amerika und
Hollywood
Marcello Mastroianni erinnert sich sehr wohl gerne an amerikanische Schauspieler,
die fast zu „Ikonen“ seiner Jugend wurden: Gary Cooper, Errol
Flynn, Clark Gable, Tyrone Power. Man ahmte ihre Bewegungen nach, man
begeisterte sich für diese Schauspieler. Schnell weist Mastroianni
aber auf die einheimischen Stars hin: Amedeo Nazzari, Anna Magnani, Aldo
Fabrizi, Totò. Genauso lobt er die französische Schauspielerelite:
Jean Gabin und Louis Jouvet. Mehr noch, Marcello Mastroianni meint, diese
europäischen Schauspieler hätten ihm und seinen Freunden näher
gestanden als die amerikanischen Kinostars.
Mastroianni sieht vor allem einen großen Unterschied in der Mentalität
des europäischen und der des amerikanischen Films. Er ist der Meinung,
dass man für eine Komödie „keine drei Wochen lang den
Text auswendig lernen“ müsse, sondern sollte vor allem auch
spontanen Humor einbringen.
Diese Abneigungen gegen Amerika und Hollywood wurzelt in der Sorge um
die Dinge, die Mastroianni sein ganzen Leben lang wichtig waren: Der italienische
Film, Intuition, Leichtigkeit und Unkompliziertheit. Selbst Neapel liebt
er vor allem deswegen, weil diese Stadt kaum amerikanische Einflüsse
aufweist.
9.2 Militär
und Heldentum
Marcello Mastroianni ist wie nahezu jeder seiner Zeit vom Weltkrieg geprägt.
Der junge Mastroianni musste keinen Militärdienst bei der Truppe
ableisten, doch arbeitete er als technischer Zeichner in Rom. Da dem angehenden
Schauspieler jede Art von Zwang zuwider war, flüchtete er aus dem
bereits den Deutschen unterstellten Instituto Geografico Militare nach
Venedig.
Marcello Mastroianni interessierte sich nicht für das Militär
und den Krieg. Er musste sich wohl gewissen äußeren Umständen
unterwerfen, tat dies jedoch nur soweit als nötig. Abgeklärt
wie er zum Zeitpunkt der Autobiographie auftritt, gibt er seine „Feigheit“
und sein Desinteresse offen zu.
Helden und Heilige sind Mastroianni unsympathisch. Er mag die Perfektion
nicht, die diesen Wesen anhaftet. Lieber ist ihm eine gewisse Menschlichkeit,
wie es Tschechow in seinen Werken versteht, die Menschen darzustellen.
So wie er sich nicht als Krieger sieht, sieht er sich auch nicht als Führernatur:
Ich bin in vielerlei Hinsicht faul und auch ein wenig
feig, wenn es darum geht, sich bestimmten Situationen zu stellen oder
bestimmte Entscheidungen zu treffen. (31)
10 Alter
Das Leben: Ja, in einem bestimmten Alter stellt man
fest, dass es einfach so vergangen ist, wie ... sst! Und das nächste
Dorf ist ganz nah. (32)
10.1 Neues
Mastroianni ist zum Zeitpunkt seiner Autobiographie 72 Jahre alt. Er beschreibt
sein Leben von einem abgeklärten Standpunkt aus, leugnet auch nicht,
dass gewisse Situationen und Begebenheiten nun in einem anderen Licht
erscheinen und er sie anders erzählt, als er sie damals erlebt hat.
Er wird im Alter nicht unbedingt vorsichtiger, er kann sich nun als Förderer
unbekannter oder riskanter Projekte betätigen: Man
stellt sich hinter einen Autor (...) und hält ihn über die Taufe.(33)
Genauso lehnt er nun große Aufträge ab, um sich bescheidenen
Projekten zuzuwenden, die er für überzeugender und vor allem
abenteuerlicher hält.
10.2 Altes
Im Zuge seiner Autobiographie kritisiert er seine Filme. Er findet manche
gut, manche weniger gut. Außerdem unterscheidet er zwischen Erfolg
und Qualität. Mit den Kommentaren zu seinen Filmen verleiht sich
Mastroianni eine gewisse Erhabenheit, man gewinnt den Eindruck, er „stünde
längst darüber“. So baut er sich eine „Aura“
von Weisheit auf, auch wenn er in diesem Zusammenhang meint:
Immer wieder hört man von der Weisheit des Alters! Aber sehen Sie
sich doch einmal einen Alten an, wie er über die Straße geht:
Zuerst schaut er rechts, dann nach links ... Aber das ist keine Weisheit,
sondern Vorsicht, Angst. (34)
Für Mastroianni ist die echte Weisheit die Lebensbejahung in allen
Situationen, er verliert seinen Optimismus auch nicht in seinem letzten
Lebensjahr. Das bekräftigt er mit seinem Credo:
Ich glaube an die Natur, an die Liebe, die Gefühle,
die Freundschaft; an diese wunderbare Landschaft; an meine Arbeit, an
meine Gefährten. Ich mag die Menschen. Ich liebe das Leben; und vielleicht
hat das Leben deshalb meine Liebe erwidert. (35)
11 Zum Abschluss
Es ist nicht möglich, anhand eine Autobiographie und einiger Informationen
rundherum ein vollständiges Bild eines Menschen zu zeichnen. Ich
denke aber, dass in einem Werk wie der Autobiographie „Ja, ich erinnere
mich“ die Meilensteine eines Lebens wohl erwähnt werden und
somit ein Leben zumindest umrisshaft skizziert werden kann. Meine Interpretation
liegt hauptsächlich in der Auswahl der Passagen, die ich behandle
und in den Schwerpunkten, die ich setzte, weniger in der Auslegung der
Aussagen Mastroiannis. Die Freiräume dazwischen sind keine willkürlichen
Auslassungen, sondern die Dinge, die ein Mensch aus verschiedenen Gründen
auch am Lebensabend für sich behält. Diese Freiräume sind
dann Gegenstand der Interpretation durch viele Disziplinen und gleichzeitig
das, was einen Menschen mit (genützten) Talenten zum Mythos macht.
12 Kurzbiographie
Marcello Mastroianni wird am 28. September 1924 in Fontana Liri bei Frosinone
(Italien) geboren. Die Familie lässt sich 1934 in Rom nieder, wo
Mastroianni aufwächst. Dort beginnt er Architektur und Volkswirtschaft
zu studieren. In den Kriegsjahren ist er auch als technischer Zeichner
tätig. Er gerät unter deutscher Besatzung in ein Arbeitslager,
flüchtete und versteckt sich bis zum Ende des Krieges.
Nach 1945: Entdeckung durch den Regisseur Luchino Visconti, Mastroianni
entwickelt sich zum gekonnten Theaterschauspieler. Ab 1948 nimmt er auch
vermehrt Filmrollen an.
1950: Heirat mit Flora Carabella, aus der Ehe geht eine Tochter hervor.
Wegen Mastroiannis zahlreicher Affären wird diese Ehe 1990 getrennt.
Aus einer vorübergehenden Beziehung mit Cathérine Deneuve
geht seine zweite Tochter hervor.
1960 gelingt ihm mit Federico Fellinis „La dolce vita“ der
endgültige Durchbruch. Fellini und Mastroianni verbindet von nun
an eine andauernde berufliche und freundschaftliche Beziehung. In den
nachfolgenden Filmen sticht besonders die Zusammenarbeit mit Sophie Loren
hervor. In den 1970er und 1980er Jahren überrascht Mastroianni mit
der Darstellung ungewöhnlicher Rollen unter der Regie Ferreris, Scolas,
Fellinis und Angelopoulos’. 1987 Jahre wird er für „Oci
Ciornie“ mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet.
Mit dem Tod Federico Fellinis im Oktober 1993 verliert Mastroianni seinen
bedeutendsten Kollegen beim Film. Marcello Mastroianni stirbt am 19. Dezember
1996 in Paris.
13 Filmographie (Auswahl)
1954 – Cronache di poveri amanti, Regie: Carlo Lizzani
1957 – Le notti bianche, Regie: Luchino Visconti
1960 – La dolce vita, Regie: Federico Fellini
1963 – Otto e mezzo, Regie: Federico Fellini
1968 – Amanti, Regie: Vittorio DeSica
1973 – La grande abbuffata, Regie: Marco Ferreri
1978 – Ciao maschio, Regie: Marco Ferreri
1987 – Der Bienenzüchter, Regie: Theo Angelopoulos
1987 – Oci Ciornie, Regie: Nikita Michalkov
1989 – Che ora è?, Regie: Ettore Scola
Anmerkungen:
(1) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, (dtv, München 1998) 37.
(2) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 32.
(3) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, Nachwort, 169.
(4) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 13.
(5) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 31.
(6) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 15.
(7) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 61.
(8) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 9.
(9) Mastroianni, Ja, ich
erinnere mich, 94.
(10) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 94-95.
(11) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 94.
(12) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 10.
(13) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 125.
(14) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 54.
(15) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 152.
(16) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 132.
(17) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 146.
(18) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 156-157.
(19) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 157.
(20) Mastroianni,
Ja, ich erinnere mich, 64.
(21) Aus:
Leo der letzte, Regie: John Boorman, In: Mastroianni, Ja, ich erinnere
mich, 17.
(22) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 11.
(23) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 18.
(24) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 54.
(25) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 163.
(26) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 45.
(27) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 11.
(28) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 43.
(29) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 92.
(30) Mastroianni,
Ja, ich erinnere mich, 163.
(31) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 19.
(32) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 166.
(33) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 102-103.
(34) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 161.
(35) Mastroianni, Ja,
ich erinnere mich, 164.
Literatur:
George L. Mosse, Das Bild des Mannes. Zur Konstruktion
der modernen Männlichkeit, Frankfurt 1997.
Andrew Spicer, Typical Men. The Representation of Masculinity
in Popular British Cinema, London 2001.
Michael Meuser, Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische
Theorie und kulturelle Deutungsmuster, Opladen 1998.
Wolfgang Schmale (Hrsg.), MannBilder. Ein Lese-
und Quellenbuch zur historischen Männerforschung, Berlin 1998.
|