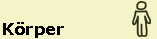|
| |
|
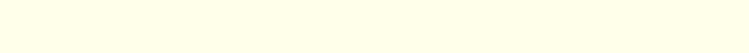
Zitieren Sie diesen Text
bitte folgendermaßen:
Hammerer, Lieselotte:
Analyse von Franz Michael Felders Autobiographie; Aus meinem Leben. In:
Webportal für die Geschichte der Männlichkeiten des Instituts
für Geschichte der Universität Wien,
http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/maennergeschichte/biographien/felder_01.htm
Franz
Michael Felder (1839 - 1869),

"Aus
meinem Leben"
Als Franz Michael Felder 1869 seine Autobiographie abschloss, war er bereits
ein anerkannter Schriftsteller, dessen beide Romane "Sonderlinge"
(1867) und "Reich und Arm" (1868) veröffentlicht waren,
ebenso Erzählungen, sozialkritische Schriften und Aufsätze in
Zeitungen und Zeitschriften. Dennoch war für ihn - wie ein Jahrhundert
früher für Ulrich Bräker - Schreiben nur ein Nebenberuf.
Beide waren Autodidakten, Felders Hauptberuf war Bauer. Der Anlass, seine
Lebensgeschichte zu schreiben, war eine tragische Zäsur in seinem
Leben, der frühe Tod seiner geliebten Frau Nanni. Mit der Arbeit
an seiner Selbstbiographie fing er an "mehr und mehr wieder aufzuleben"[1]
(S. 186), das Schreiben wurde ihm in der schweren Zeit der Trauerarbeit
"zum festen Punkt, an dem ich mich zu halten suchte" (ebd. S.
220). Wie Ulrich Bräkers Lebensgeschichte entstand die Autobiographie
Felders also in einer Zeit einer schweren menschlichen Krise. Felders
erste Reflexionen über sein Leben begannen mit Tagebuchaufzeichnungen,
seiner "Welt des Herzens" (S.175). Dort versuchte er seine Klagen
über die "hiesige Gesellschaft" (S. 229) niederzuschreiben
und "die Quelle des Unmutes so stark fließen [zu] lassen, dass
sie gar bald versiegen musste, und dann klein und lächerlich erschien,
was mir vorher unerträglich war" (S. 226).
Felder kritisiert die Erziehungsmaßnahmen der bäuerlichen Eltern
seiner Zeit, deren "ganze Erziehung einzig nur darauf hinausgeht,
im zweiten Jahrzehnt ja mit dem Kind wieder so viel hereinzubringen, als
das erste seines Lebens an Barem und die Erziehung oder vielmehr Abrichtung,
an Zeit gekostet haben mag" (S. 28). Seine Eltern jedoch umgaben
ihn mit "vielleicht nur zu vieler Sorgfalt" (ebd.). In der engen,
dörflichen Welt des Bregenzerwaldes wird Abweichen von der Tradition
als ungewöhnliches Verhalten gebrandmarkt. So bleibt Felders Vater
der Arbeit fern, um seiner Frau bei der Geburt beistehen zu können,
was die öffentliche Dorfmeinung als "schlimme Vorbedeutung"
(S. 19) ansieht.
Die Dorfgesellschaft achtet Schule und Lernen gering. So "muss es
der Lehrer fast für eine Gnade halten, dass man ihm auch diejenigen
Kinder zuschickt, die anderwärts einen Kreuzer verdienen könnten"
(S. 54). Felders Vater dagegen reagiert auf das Vorlesen der ersten gedruckten
Zeilen durch seinen Sohn, indem er ihn küsst. Solche Zeichen der
Zuneigung waren etwas ganz Besonderes, wie Felder auch in seiner Erzählung
"Liebeszeichen" (1868) betont. Lesen und Lernen galt für
einen tüchtigen Mann nach der öffentlichen Meinung als unnütze
Zeitverschwendung, man wollte keinen klugen Kopf, "keinen aufgeklärten
Sonderling, sondern einen nützlichen Menschen" (S. 57). Felder
erkannte früh, dass alle im Dorf vom Urteil der öffentlichen
Meinung abhängig waren und alles um des "lieben Scheines wegen"
(S. 227) taten, um des Beifalls des Bürgermeisters sicher zu sein
oder sich nicht dem Zorn des Pfarrers auszusetzen. Als Achtjähriger
konnte Felder in der Sonntagsschule, die alle Jugendlichen vom 14. bis
24. Lebensjahr nach der Pflichtschule besuchen mussten, Fragen über
den Katechismus und über die Sonntagspredigt beantworten, während
von den Jugendlichen niemand eine Antwort wusste. So wurde er zu einer
"öffentlichen Persönlichkeit" (S. 59).
Seine Behinderung - er sieht auf einem Auge schlecht, das andere wurde
durch einen betrunkenen Arzt, der dem Kleinkind das falsche Auge operiert
hatte, verdorben - hielt ihn nicht davon ab zu zeigen, dass er der "kühnste,
der gewandteste" (S. 28) unter seinen Spielkameraden sein wollte,
den die Bewunderung der Eltern "zu immer noch kühneren Wagnissen
getrieben hatte" (ebd.). Als er eine Tanne erklettert, um den Mädchen
"Tannenkühe"(Tannenzapfen, S.30) herunter zu schütteln,
hat er "zum ersten Mal im Leben die Empfindung, dass ich ein Mann
sei" und wirft drei Buben, die den Mädchen die Tannenzapfen
streitig machen, "nieder mit einer Kraft und Gewandtheit, über
die ich selber noch erstaunter war als die anderen" (ebd.).
Dem hegemonialen Männlichkeitskonzept, das langsam auch ein so abgelegenes
Dorf wie Schoppernau im hinteren Bregenzerwald erreichte, entsprach Felder
jedoch schon als Jugendlicher nicht mehr, ebenso wie er die Stellung,
die ihm als Kleinbauer in der Gemeinde zugewiesen wurde, nicht akzeptieren
wollte. Als Knabe ließ er sich zwar auch von der Kriegsbegeisterung
des Jahres 1848 mitreißen und ahmte mit anderen Kindern, zu deren
Hauptmann er gewählt wurde, das Exerzieren der jungen Burschen des
Dorfes "unter der Aufsicht eines ausgedienten Kaiserjägers"
(S. 69) nach. Aber viel mehr befriedigte ihn die Tatsache, dass während
der Ereignisse des Revolutionsjahres das Lesen von Zeitungen in der öffentlichen
Meinung nicht mehr als Zeitverschwendung galt und das Gelesene in Gesprächen
diskutiert wurde (Vgl. S. 69f). Felder schreibt auch über das Jahr
1859, aber nicht in militärischer Begeisterung, sondern er kritisiert
die politischen Ereignisse in seinem Tagebuch; er wagt sie vorerst nicht
öffentlich auszusprechen. Als die einheimischen Geistlichen von der
Kanzel den Krieg in Italien als Religionskrieg bezeichnen, um die ländliche
Bevölkerung in Kriegsbegeisterung zu versetzen, übt er Kritik
am "guten Einvernehmen zwischen Staat und Kirche" (S. 254) sowie
an der weltlichen Herrschaft des Papstes. Am 18. Juni 1859 schreibt er
in sein Tagebuch ein Gedicht "Geheimste Soldatengedanken", das
sich pazifistisch mit dem Krieg und dem Feind beschäftigt. Er schließt:
"Ich seh' als Gegner mancher Mutter Kind, doch nur gezwungen geht's
der Fahne nach" (S. 256).
Vor allem sieht er den großen wirtschaftlichen Schaden durch den
Krieg für sich und die anderen Bauern, die von den Lechtaler Käsehändlern
völlig abhängig sind. Diese Abhängigkeit versucht er zu
bekämpfen, indem er sich als Gemeindevertreter aktiv politisch betätigt
und das Genossenschaftswesen entwickelt. Er gründet eine Viehversicherungsanstalt
und beschließt mit seinem Schwager, Kaspar Moosbrugger, 1866 die
Gründung der "Vorarlbergischen Partei der Gleichberechtigung".
Aber immer wieder muss er gegen das "verknöcherte Bauerntum
mit seinen verschiedenartigen Vorurteilen" (S. 250) ankämpfen.
So ist das Wort ‚Sonderling' genau so wie ‚öffentliche
Meinung' ein Leitmotiv seines ganzen literarischen Werkes, nicht nur seiner
Lebensgeschichte. Felder stellt sich außerhalb des fest umrissenen
bäuerlichen Männerbildes, auch wenn er immer wieder um Anerkennung
wirbt.
In Felders Selbstbiographie nehmen Lesen und Lektüre einen wichtigen
Platz ein. Als er starb, hinterließ er etwa 700 Bücher, die
er unter großen finanziellen Entbehrungen erworben hatte. Zunächst
bestellte er Zeitungen und Zeitschriften. Seine erste Zeitung, eine Nummer
des "Dorfbarbiers", bekam er, weil der Krämer darin Seife
einpackte. Seine zweite Zeitung war "Die Gartenlaube". Da im
Dorf vorher nur der Vorsteher, der Lehrer und der Pfarrer Zeitungen bestellt
sollten, die mit großer Verspätung vom Postamt Bezau abgeholt
wurden und nach Lesen und Zensur an andere Dorfbewohner Tage später
weitergereicht wurden, war das Bestellen einer Zeitung durch einen jungen
Burschen eine Anmaßung und ein Bruch mit jeder Tradition. Mit den
Zeitungsabonnements begann Felder Lesegesellschaften um sich zu sammeln.
Es kam zu Vorleseabenden und man kann sagen, dass alle mitmenschlichen
Beziehungen Felders in engem Zusammenhang mit dem Lesen und dem Gespräch
über Gelesenes oder Geschriebenes stehen. Das Lesen aber schloss
ihn immer mehr aus der praktischen dörflichen Gemeinschaft aus, in
der er sich als Fremder und Außenseiter fühlte. Aber in der
Stadt - dies zeigt sein Besuch in der Buchhandlung in Lindau - empfand
er seine Mundart als Sprachbarriere und seine Kleidung als ärmlich.
Er fühlte "dass wir Bregenzerwälder nicht nur durch unsere
Berge, sondern viel mehr noch durch Erziehung und Gewohnheit von der Welt
abgeschlossen waren" (S. 95). Im Dorf fiel er mit dem neuen Anzug,
den er in Bregenz gekauft hatte, negativ auf, "die fremde Kleidung
war gleichsam eine Mauer geworden" (S. 198), die ihn von den Mitmenschen
trennte. Auf der Alpe in Hopfreben gelang es ihm "mit Torheiten den
Riss zu überbrücken" (S. 207), aber sobald er wieder "seinen
Büchern zueilte", wurde die "Brücke" (ebd.),
die er zu den anderen gesucht hatte, wieder weggerissen. Diese Metapher
leitet schon auf die entscheidendste Zäsur in Felders Leben hin:
Seinen Sturz beim Viehtreiben von der zusammenbrechenden Brücke in
die Bregenzerache, dem kathartischen Ereignis, das sein Verhältnis
zu den Menschen des Dorfes verändert, ihn läutert und ihn und
Nanni erkennen lässt, dass sie zusammengehören und heiraten
wollen. Nanni, der Felder kurz nach der Vollendung seiner Selbstbiographie,
weniger als ein Jahr später im Tode nachfolgt, war ihm eine ebenbürtige
Gefährtin. Sie lenkte und erzog ihn, sie "hatte durch Lesen
ihr Geistesleben bereichert, ohne dass sie sich darum dem Alltäglichen
abwandte" (S. 215). Durch sie und ihre Familie erkannte Felder, "dass
eine bessere Ausbildung nicht unfähig mache, in meiner Heimat nach
der Väter Weise zu leben und zu arbeiten" (S. 223f). 80 Jahre
früher stilisierte Bräker seine Ehefrau zu einer ‚Dulcinee'
und zänkischen ‚Xantippe', in der Bräkers Lesewut Ekel
und Widerwillen gegen jedes Buch erweckte. Nanni dagegen förderte
ihren Mann und bestärkte ihn in seiner Berufung als Dichter und Bauer.
Felders Männer- und Frauenbild entsprichen eher dem der Aufklärung
als dem des 19. Jahrhunderts, in dem er lebte. Die Frau wird jedoch als
Teilhaberin der Verhältnisse des Mannes, ja sogar als seine Erzieherin
gesehen, die frei und eigenständig denkt. Nanni Moosbrugger, Felders
Frau, schreibt auch Gedichte und Tagebücher und liest mit Begeisterung
die Bücher ihres studierten Bruders Kaspar. Felder selbst löst
sich von der traditionellen Rolle des Bauern, er sieht sich als Außenseiter,
als Dichter. Die Aufweichung der Standesgrenzen durch autodidaktische
Bildung - er ist im Briefwechsel mit Akademikern - und harte Auseinandersetzungen
mit Pfarrer Rüscher wegen der von Felder gegründeten Leihbibliothek
des Handwerkervereins - all das sind verspätete Auswirkungen der
Aufklärung, die sich im hinteren Bregenzerwald erst mit zeitlicher
Verschiebung durchsetzt. Schon früh hinterfragt Felder die kirchliche
Moral, die den Menschen ihr Unglück als Strafe für ihre Sünden
erklärt. Als Felder 10 Jahre alt ist, stirbt sein Vater plötzlich
und er bleibt mit seiner Mutter und dem Gottle, der unverheirateten jüngeren
Schwester des Vaters, zurück, die vier Jahre später stirbt.
Er kann das fromme Gottvertrauen der Mutter nicht teilen, er ist voll
Unruhe und Zweifel: "Alle waren frommer und glücklicher als
ich" (S. 95). Die Biographie liest sich in manchen Teilen wie eine
Selbstanalyse, die auch die dunklen Seiten bis zu Suizidgedanken nicht
ausspart. Das entspricht Rousseau, der in seinen Memoiren "Les confessions"
am Ende des 18. Jahrhunderts sein Innerstes enthüllt und ‚Transparenz
der Herzen' fordert oder Goethes "Leiden des jungen Werther".
Felder schließt den 1. Teil seiner Selbstbiographie, deren 2. Teil
ihm nicht vergönnt war zu schreiben, da er noch vor Vollendung seines
30. Lebensjahres starb, mit der Erkenntnis, "dass das Schicksal den
Menschen nur darum zuweilen zu verfolgen scheint, damit er etwas von dem
belastenden Gepäck abwerfe und umso schneller und sicherer einem
seiner würdigen Ziele entgegen komme" (S. 288).
Anmerkungen:
[1]
Franz Michael Felder, Briefwechsel mit Kaspar Moosbrugger 2.Teil.
Bearbeitet von Eugen Thurnher. Sämtliche Werke Bd. 6 (Bregenz 1972)186
u. 220.
Alle anderen Seitenangaben beziehen sich auf Franz Michael Felders Autobiographie:
Aus meinem Leben. Bearbeitet von Walter Strolz. Sämtliche Werke Bd.
4, ed. Franz Michael Felder-Verein (Bregenz 1974).
Literatur:
Felder, Franz Michael: Aus meinem Leben. Bearbeitet
von Walter Strolz. Sämtliche Werke Bd. 4, ed. Franz Michael Felder-Verein
(Bregenz 1974).
Moosbrugger, Maria Katharina: Autobiographie und gesellschaftliche
Situation - Ein Vergleich von zwei Autobiographien aus dem Bodenseegebiet
( unveröffentlichte Hausarbeit, Salzburg 1981).
Felder, Franz Michael: Sämtliche Werke. Bde.
1 - 8 (Bregenz 1974 - 1979).
|